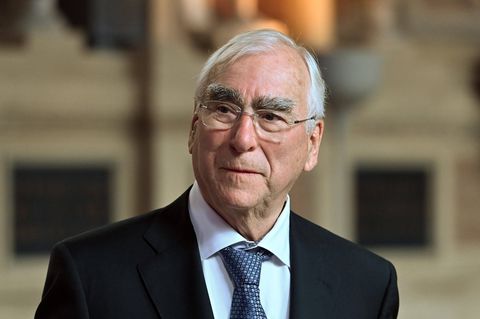Herr Westphal, Sie haben Kinder in Kriegs- und Krisenregionen in verschiedenen Ländern besucht. Welcher Besuch ist Ihnen am stärksten im Gedächtnis geblieben?
Das war ein Gespräch mit einem etwa zwölfjährigen Jungen aus der Stadt al-Hudaida im Jemen. Er war mit seinen Eltern vor den schweren Kämpfen dort geflohen und, nachdem die Kampfhandlungen zu Ende waren, wieder zurückgekehrt. Er erzählte, wie er gemeinsam mit seinen Freunden in ihrem Viertel unterwegs war und einen glitzernden, metallischen Gegenstand fanden. Es war eine noch nicht explodierte Bombe, die dann hochging. Einer der vier Jungen starb, die anderen drei Jungen wurden schwer verletzt. Dem Zwölfjährigen musste das Bein amputiert werden.Ich habe ihn in der Schule getroffen, die er jetzt mit seiner Prothese besucht. Für den Jungen ist es superwichtig, dass er mit der Einschränkung lernen kann. Das nährt die Hoffnung, sich einmal eine Zukunft aufbauen zu können.
Also doch Lebensmut statt Resignation?
Wir als Organisation versuchen das natürlich zu stärken. Gerade mit Bildung kann man viel erreichen. Aber man darf die Situation vor Ort auch nicht beschönigen. Bei meinem letzten Besuch waren die Folgen des Krieges für die Kinder überall zu sehen. Sie leben in Armut, vor allem die Binnengeflüchteten. Es herrscht Mangelernährung, Krankenhäuser funktionieren nicht mehr und darunter leiden besonders die unter Fünfjährigen. Familien leben mit zwölf Personen zusammen und haben Probleme, ein bisschen Reis für die Kinder aufzutreiben. Kinder können nicht zur Schule gehen. Das prägt das ganze Leben.
Inwiefern?
Sie werden früh gezwungen, mit diesen Realitäten klarzukommen. Das habe ich auch in meiner Zeit im Osten der Demokratischen Republik Kongo 1999/2000 beobachtet. Vieles hat sich dort bis heute kaum verändert. In Afghanistan habe ich einen 14-jährigen Jungen kennengelernt, der einen großen Teil seines Lebens Lasten getragen und Karren auf der Straße gezogen hat, um Geld für die Familie zu verdienen. Kinder sind dort schon im Alter von sieben oder acht Jahren in der brutalen Realität des Erwachsenenlebens angekommen und kämpfen täglich ums materielle Überleben. Da bleibt keine Zeit für das, was wir mit Kindheit verbinden. Wenn man mit diesen Kindern spricht, dann wirken sie oft viel älter als sie eigentlich sind.
Verstehen die Kinder die Kriege, die um sie herum wüten?
Das kommt auf das Alter an. Und als Außenstehender muss man sehr vorsichtig sein, wie man das Thema anspricht. Wir machen sehr viel psychosoziale Betreuung und versuchen den Kindern Schutz- und Spielräume zu geben, wo sie für ein paar Stunden aus der Realität ausbrechen, miteinander spielen oder malen können. Meine Kolleginnen und Kollegen in den Schutz- und Spielräumen berichten von unerklärbaren Wutausbrüchen, dass Kinder einfach anfangen zu weinen und die Gründe dafür nicht direkt ausdrücken oder erklären können.
Dass die Kinder das Erlebte abstreifen, ist unwahrscheinlich, aber sie können lernen, damit zu leben.
Wie kann man den Kindern helfen?
Es ist wichtig, ein Umfeld zu haben, dem die Kinder vertrauen. Häufig fangen sie dort selbst an zu kommunizieren, was sie erlebt haben. Das haben wir etwa bei den ukrainischen Kindern in Deutschland beobachtet, mit denen wir arbeiten. Es kann eine Zeichnung sein, aber auch eine Anekdote, die die Kinder erzählen. Natürlich kann man ihnen ein Gesprächsangebot machen. In Deutschland unterstützen wir eine Organisation namens krisenchat, die psychosoziale Unterstützung für Kinder und Jugendliche aus der Ukraine per Messengerdienst anbietet. Es braucht ein niedrigschwelliges Angebot, dass die Betroffenen anspricht. Wenn man diese Unterstützung nur als medizinische Leistung ansieht, dann besteht das Risiko, dass sie nicht angenommen wird. Leicht zugängliche Gesprächsangebote geben mehr Sicherheit. Dass die Kinder das Erlebte einfach abstreifen, ist unwahrscheinlich, aber sie können lernen, damit zu leben.
Fast eine halbe Milliarde Kinder lebt in Konfliktgebieten, das hat Ihre Organisation Save the Children herausgefunden. Hat Sie das Ergebnis überrascht?
Leider nein. Weltweit gibt es mehr Konflikte, in denen das humanitäre Völkerrecht mit den Füßen getreten wird. In der Demokratischen Republik Kongo beispielsweise finden Konflikte ohne Regeln statt. Das belegt auch die verheerende Zahl der betroffenen Kinder.
Zivile Opfer sind doch eigentlich unvermeidbar?
Kriege ohne zivile Opfer gibt es leider nicht, aber es lässt sich vermieden, dass so viele Kinder betroffen sind. Wenn sich die Konfliktparteien an die geltenden Regeln des humanitären Völkerrechts halten würden, wären die Folgen für die Kinder weit weniger gravierend.

Haben Sie ein Beispiel?
Eine der häufigsten Kinderrechtsverstöße ist die Rekrutierung von Kindersoldaten.
Laut Genfer Konvention und der Internationalen Konvention über Rechte des Kindes ist der Einsatz von Kindersoldaten unter 15 Jahren verboten und gilt vor dem Internationalen Strafgerichtshof als Kriegsverbrechen. Die UN-Kinderrechtskonvention hat das Mindestalter für Militäreinsätze sogar auf 18 Jahre festgelegt.
Alle bewaffneten Akteure wissen, dass es illegal ist, Kinder zu rekrutieren. Kinder nehmen von den Erfahrungen unglaublichen Schaden. Sie werden in Gefahr gebracht, verlieren den Anschluss, den Kontakt zur Familie, können nicht mehr zur Schule gehen und werden nicht anständig versorgt. Dabei gibt es absolut keine stichhaltige Rechtfertigung dafür, Zwölfjährige mit einer Maschinenpistole in eine Rebellengruppe einzusortieren.
Kinder bedeuten die militanten Gruppen Nachschub und eine Möglichkeit, die eigene Macht zu festigen.
Das ist eine sehr zynische, aber leider auch reale Sichtweise. Viele Menschen sind bereit, für die eigenen Zwecke Kinder zu missbrauchen und ihre Rechte zu verletzen. Ein anderes Beispiel dafür sind die Angriffe auf Schulen. Auch dafür gibt es keine Rechtfertigung. Manchmal werden Schulen als militärische Einrichtungen missbraucht In der Ukraine beispielsweise wurden viele einfach wahllos bombardiert.
In dem Bericht "Krieg gegen Kinder: Kinder brauchen Frieden" von Save the Children steht, dass die Zahl der Rekrutierungen um 20 Prozent gestiegen ist. Von welchen Ländern sprechen wir da?
Die meisten Fälle der Rekrutierung von Kindern fanden im letzten Jahr in Syrien, der Demokratischen Republik Kongo, Somalia und Mali statt. Der Anstieg ist unter anderem auf erhöhte Zahlen in Syrien und Mali zurückzuführen, sowie Fälle in Mosambik. Die drei Konfliktländer, in denen es 2022 insgesamt am gefährlichsten war, ein Kind zu sein, waren die Demokratische Republik Kongo, Mali und Myanmar. Aber es gibt viele Länder, in denen Kinder gekidnappt werden, um sie zu rekrutieren.
Armut und fehlende Eltern sind zwei Hauptgründe, warum Kinder nicht in der Schule, sondern in einer bewaffneten Gruppe enden.
Sie werden nicht angeworben?
Es gibt Fälle, in denen die Gruppen auf die Kinder zugehen. Aber man kann auch nicht ausschließen, dass der Druck aus dem eigenen Umfeld die Kinder zum Militäreinsatz treibt – gerade bei den Jungen. Manche gehen aber auch freiwillig.
Warum?
Ein 17-Jähriger aus dem Kongo hat erzählt, dass er vor fünf Jahren durch den Konflikt von seinen Eltern getrennt wurde, die ins Nachbarland fliehen musste. Er wollte zur Schule gehen, aber ihm fehlte das Geld, um sich zu ernähren. Dann wurde seine Community angegriffen und am Ende schloss er sich einer bewaffneten Gruppe an, um sich gegen Angriffe verteidigen zu können. Aber das ist ein Teufelskreis. Wenn die Kampfhandlungen enden oder pausiert werden, dann werden die Kinder und Jugendlichen nicht entlassen, sondern systematisch weiter ausgenutzt. Armut und Trennung von der Familie sind zwei häufige Gründe, warum Kinder nicht in der Schule, sondern in einer bewaffneten Gruppe enden.
In welchem Alter werden die Kinder rekrutiert?
Das ist schwer zu sagen. Während meiner Zeit im Kongo sah ich Kinder, die kaum größer waren als das Gewehr, das sie trugen. Die können damit wohl kaum älter als elf, zwölf Jahre gewesen sein.
Und die werden dann direkt in den Einsatz geschickt?
Kinder sind oft dafür zuständig, Essen zu beschaffen – ein Junge erzählte uns, dass er regelmäßig Lebensmittel geklaut hat. Dann gibt es auch Zwangsrekrutierungen von Mädchen, die kochen, sich ums Trinkwasser kümmern oder saubermachen müssen. Mädchen werden auch für den sexuellen Missbrauch rekrutiert. Manche Kinder werden für Spionage eingesetzt, weil sie weniger auffallen als Erwachsene. Mit solchen Aufgaben steigen Kinder ein und werden dann irgendwann auch in die Kämpfe hineingezogen. Manchmal dienen sie auch als menschliche Schutzschilde.
Wie können Hilfsorganisationen Kinder davor schützen?
Ein gesichertes Umfeld mit Familie, Schule und medizinischer Versorgung senkt das Risiko ungemein. In festen Strukturen müssen sich Kinder nicht allein auf der Straße durchschlagen. Wir dringen bei Behörden und Regierungen, mit denen wir zusammenarbeiten, darauf, dass gegen diese militärischen Gruppen vorgegangen wird. Aber es gab auch schon Regierungen, die unter 18-Jährige zwangsrekrutiert haben.
Kann man diese Kinder aus den Gruppen retten?
Im Ostkongo haben wir zum Beispiel mit einer lokalen NGO zusammengearbeitet, der es durch intensive Verhandlungen mit bewaffneten Gruppen sehr gut gelingt, Kinder zu befreien.
Das Tragische ist: Kinder werden zu Opfern und Tätern.
Und wie geht es dann weiter?
Mit Jugendlichen ab 15 Jahren versuchen wir eine wirtschaftliche Existenz aufzubauen. Sie bekommen eine Ausbildung, die sie auch davor beschützen soll, wieder zu der bewaffneten Gruppe zurückzukehren. Das ist schwierig, weil das Einzige, was uns bleibt, die Überzeugungsarbeit ist. Jüngere Kinder versucht man, so gut wie möglich, zu ihren Familien zurückzubringen oder man sucht eine Adoptivfamilie für sie. Auch werden sie in die Schule gebracht. Als Hilfsorganisation muss man natürlich auch darauf schauen, was an den Schulen gelehrt wird.
Wie in Palästina? An UN-Schulen im Gazastreifen beispielsweise sollen sich radikale Palästinenser getummelt haben und Hass und Gewalt verherrlichende Gedichte gelehrt worden sein. 2001 schritt dann wohl auch das EU-Parlament ein.
Wenn die Inhalte nicht mit unseren Werten übereinstimmen und mit den Kinderrechten nicht vereinbar sind, würden wir uns dort auch zurückziehen. Man muss aber auch dazu sagen, dass Lehrpläne normalerweise von den Regierungen kontrolliert werden. Wenn diese so den Unterricht beeinflussen wollen würden, könnten sie es tun.
Was macht es so schwierig, die Kindersoldaten einfach so wieder in die Gesellschaft zu integrieren?
In Sierra Leone, wo ich einmal gearbeitet habe, habe ich diese Debatte mitverfolgt. Kindersoldaten wurden zu furchtbaren Verbrechen gezwungen, die sie auch in ihren eigenen Dörfern begehen müssen. Das macht es natürlich schwierig, dass diese Kinder von ihrer eigenen Gruppe wieder akzeptiert werden. Dafür gibt es keine pauschale Lösung. Wenn es gar nicht funktioniert, dann müssen Einrichtungen geschaffen werden, in denen die Kinder betreut werden. Das Tragische an der ganzen Sache ist, dass diese Kinder gleichzeitig Opfer und Täter sind. Man kann sie nicht wie Erwachsene zur Verantwortung ziehen. Sie können ihr Handeln noch nicht richtig gut beurteilen, schon gar nicht, wenn sie extremem Druck ausgesetzt sind. Deswegen ist es so wichtig, dass wir uns dafür einsetzen, betroffene Kinder medizinisch und psychologisch zu unterstützen, ihnen eine Ausbildung ermöglichen und sie langsam wieder in Familien und Gemeinden eingliedern.