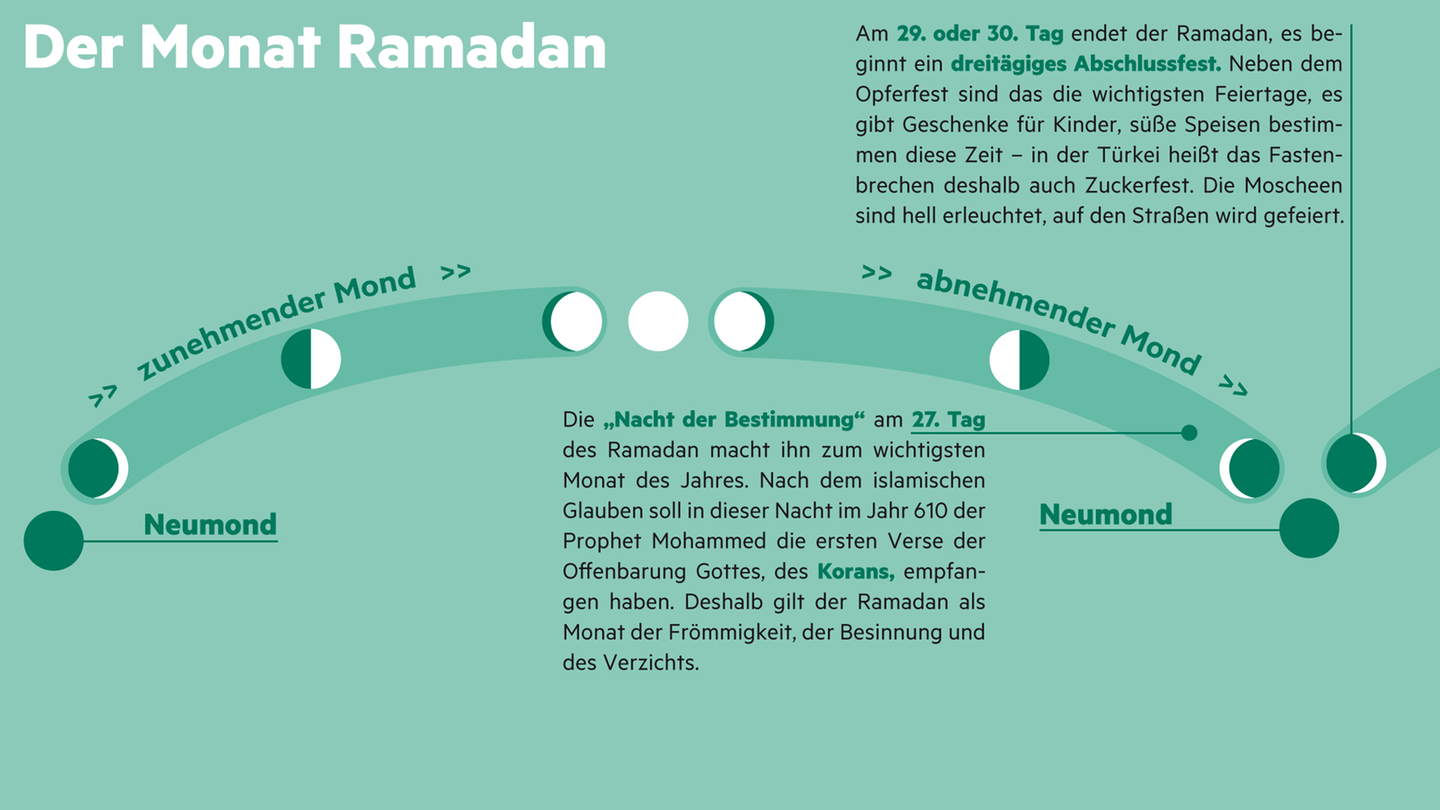Wenn an diesem Freitag weltweit knapp zwei Milliarden Muslime das islamische Opferfest begehen, dann ist das nicht nur ein religiöses Ritual. Es ist eine Feier, die Glaube, Gemeinschaft und Großzügigkeit miteinander verwebt. Eid al-Adha, auf Türkisch Kurban Bayramı, ist das bedeutendste Fest des Islams – vier Tage lang. Es markiert den Höhepunkt der Wallfahrt nach Mekka, der Hadsch, und berührt zentrale Werte: Hingabe, Dankbarkeit, Mitgefühl.
In seiner Bedeutung vergleichbar mit Weihnachten, ist das Opferfest kein festes Datum im Kalender, sondern wandert durch das Jahr – gelenkt vom islamischen Mondkalender. Es ist ein Fest, das verbindet: Vergangenheit mit Gegenwart, Gläubige mit Bedürftigen, Familien mit ihrer Geschichte.
Ein Tag des Gebets – und der Erinnerung
Der Tag beginnt früh. Die Moscheen füllen sich mit Menschen in festlicher Kleidung – oft neu gekauft oder liebevoll hergerichtet. Das gemeinsame Festgebet, getragen von ruhiger Andacht und leiser Freude, wirkt wie ein Herzschlag der Gemeinschaft. Im Anschluss an das Gebet reicht man sich die Hand, tauscht Wünsche aus: Frieden, Segen, Gesundheit – und begrüßt sich mit dem traditionellen As-salamu alaykum.

Der Autor
Asif Malik ist Dipl.-Betriebswirt und MBA. In Hamburg führt er als Unternehmer ein Immobilienmaklerbüro und eine Personalberatung. Ehrenamtlich engagiert er sich seit 20 Jahren im interreligiösen Dialog und ist Mitinitiator zahlreicher integrativer Projekte
Danach wird es stiller. Viele Muslime besuchen die Gräber ihrer Verstorbenen. Es wird aus dem Koran gelesen, leise gebetet. Die Geste ist einfach, doch bedeutungsvoll: eine Erinnerung an das, was bleibt – Liebe, Verantwortung, Verbundenheit.
Zum Opferfest kommen Gäste
Und dann: Leben. Häuser öffnen sich, Gäste kommen und gehen. Kinder flitzen durch die Räume, bekommen Süßigkeiten, Geldgeschenke. Man gratuliert sich, isst gemeinsam, lacht. In Deutschland lauten die gängigen Festgrüße: "Eid Mubarak" (arabisch, international verständlich) oder auf Türkisch: "Kurban bayramınız mübarek olsun" – "Ein gesegnetes Opferfest!" Das Fest ist im Hier und Jetzt angekommen.
Im Zentrum des Festes steht eine Geschichte, die gläubige Menschen weltweit verbindet – Muslime, Juden, Christen. Abraham, der bereit ist, seinen Sohn zu opfern. Und Gott, der diesen Gehorsam sieht – und eingreift. Der Sohn wird verschont, ein Tier tritt an seine Stelle. Eine Prüfung des Vertrauens. Ein Akt des Glaubens.
Opfertier wird mit Verwandten und Armen geteilt
Muslime erinnern sich an diese Geschichte, indem sie ein Tier opfern – ein Schaf, eine Ziege, ein Rind. Doch es geht um mehr als Fleisch. Das Tier muss gesund sein, würdig behandelt, nach bestimmten Regeln geschlachtet. Das Fleisch wird aufgeteilt: Ein Drittel bleibt in der Familie, ein Drittel geht an Verwandte und Freunde, ein Drittel an Bedürftige. In vielen Ländern ist dies für arme Menschen oft die einzige Gelegenheit im Jahr, Fleisch zu essen.
In Deutschland und anderen westlichen Ländern verzichten die meisten auf das Schlachten selbst. Sie spenden stattdessen an Hilfswerke, die das Opfern dort übernehmen, wo die Not groß ist: in Kriegsgebieten, Flüchtlingslagern, armen Dörfern. Organisationen wie Islamic Relief, Humanity First oder lokale Moscheevereine machen das möglich – mit wenigen Klicks, aber viel Wirkung.
Ein Fest, das Fragen stellt
Eid al-Adha ist mehr als ein Brauch. Es ist eine Einladung zur Selbstbefragung: Was bin ich bereit zu geben? Worauf kann ich verzichten? Wem kann ich helfen – heute, jetzt, ganz konkret?
Diese Fragen klingen ungewohnt in einer Zeit, die vom Ich geprägt ist. In der das Mehr zählt, nicht das Weniger. Doch genau darin liegt die Kraft des Festes: Es setzt dem Konsum das Teilen entgegen. Der Isolation die Gemeinschaft. Der Angst das Vertrauen.

Familien kommen zusammen, nehmen Urlaub, reisen über Ländergrenzen hinweg. Küchen stehen den ganzen Tag nicht still. Es wird gekocht, gelacht, diskutiert. Kinder lernen, was es heißt, Teil von etwas Größerem zu sein – einer Familie, einer Geschichte, einer Verantwortung. In der Diaspora, etwa in Deutschland, wird das Fest oft besonders intensiv gefeiert – als Zeichen von Identität, Verwurzelung, Stolz.
Und es ist offen. Immer mehr muslimische Gemeinden laden bewusst zum Mitfeiern ein. Mit Nachbarn, Kollegen, Freunden. Interreligiöse Begegnungen, offene Moscheetage, gemeinsames Essen – gelebte Gastfreundschaft. Wer muslimische Freunde oder Kollegen hat, darf also gerne mit einem herzlichen "Eid Mubarak!" gratulieren – das kommt an und wird geschätzt.
Das Opferfest überwindet Gräben
Eid al-Adha ist ein Fest der Sinne und der Seele. Es erinnert an das Vertrauen, das wir füreinander brauchen. An die Verantwortung, die wir tragen. An die Schönheit des Teilens – materiell und menschlich. In einer Welt, die oft von Spaltung erzählt, bietet dieses Fest eine andere Geschichte: die vom Verbinden.
Gerade in Zeiten gesellschaftlicher Polarisierung wirkt das Opferfest wie ein stiller Gegenvorschlag. Es ruft nicht laut, es lädt ein. Zum Zuhören. Zum Mitfühlen. Zum Überwinden von Gräben.