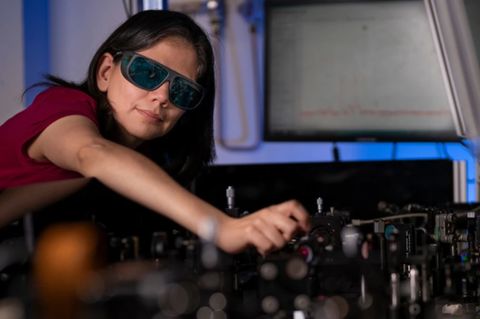Den einen früher, den anderen später, doch treffen wird es uns irgendwann alle: die Fehlsichtigkeit. Ab dem 40. Lebensjahr verweigern sich die Augen zunehmend dem Kleingedruckten, weil das Autofokussystem des Auges ermüdet: der Ziliarmuskel. Er umschließt die Linse ringförmig. Wenn wir in die Ferne blicken, ist er entspannt. Fokussieren wir zum Beispiel von einem Berg auf Buchstaben direkt vor unseren Augen, zieht er sich zusammen und stellt wie der Zoom-Motor einer Kamera auf den Nahbereich ein. Bei Kleinkindern ist die Elastizität der Linse so ausgeprägt, dass sie Gegenstände in fünf Zentimeter Abstand bestens erkennen.
40-Jährige vermögen das noch auf 17 Zentimeter Entfernung. Mit etwa 45 Jahren ist der Punkt des nächsten Sehens auf über 30 Zentimeter weggerückt - und eine Lesebrille fällig. Auch Qualität und Menge der Tränenflüssigkeit, die das Auge säubert und desinfiziert, lassen mit zunehmendem Alter nach. Zu spüren bekommen das vor allem Menschen, die beruflich ständig auf Buchstaben und Bildschirme starren. Denn sie blinzeln dabei weniger, sodass die Lidschläge das Auge seltener mit dem Feuchthaltenass benetzen.
Gutes Sehen im Alter beginnt in der Kindheit
Die Grundlagen für ein gutes Sehen werden bereits im Kindesalter gelegt. daher gehört der Sehtests zum festen Bestandteil der U8-Vorsorgeuntersuchungen. Dennoch wird bei etwa der Hälfte der Kinder eine Fehlsichtigkeit nicht erkannt. Sehschwächen fallen dann erst in der Schule auf, durch zusammengekniffene Augen, Kopfschmerzen und manchmal gar durch Rechtschreib- und Leseschwächen. Wer schlecht sieht, kann auch nur schwer lesen. Ohne eine Korrektur der Fehlsichtigkeit kann sich das Auge des Kindes jedoch nicht mehr voll entwickeln, mit Folgen für das Erwachsenenalter.
Spätestens fällt Fehlsichtigkeit dann bei der Augenuntersuchung für den Führerschein auf. Wer mit 20 bereits eine Kurz- oder Weitsichtigkeit hat, wird spätestens ab Ende 30 eine Verstärkung der Fehlsichtigkeit erfahren. Müde, brennende Augen und Kopfschmerzen, sind dafür erste Anzeichen. Der jährliche Check beim Augenarzt sollte dann zum Routinetermine werden, um eine Verschlechterung der Sehfähigkeit möglichst frühzeitig zu erkennen und zum Beispiel mit einer neuen Brille entgegenzuwirken.
Auch Gähnen beim Fahren kann an den Augen liegen
Ab Mitte 40 beginnen bei den vielen Menschen dann auch die ersten Anzeichen einer Altersfehlsichtigkeit. Das Sehen in der Nähe wird unscharf und mühsam. Im Straßenverkehr lassen sich Hinweisschilder erst spät klar erkennen, in der Nacht blenden die Lichter der anderen Fahrzeuge stärker als früher. Auch häufiges Gähnen beim Autofahren kann ein Anzeichen von Fehlsichtigkeit sein. Spätestens dann sollte ein Augenarzt oder zumindest ein Optiker einen Sehtest durchführen.
Ab Ende 50 steigt das Risiko einer ernsten Augenerkrankung. Bei Erwachsenen gehören vor allem der so genannte Grüne Star, die Makuladegeneration (AMD) und der Graue Star zu den häufigsten Augenerkrankungen. Diese Erkrankungen sind wegen ihres schleichenden Verlaufs so tückisch. Rechtzeitig erkannt, lassen sie sich oft gut behandeln. Daher sollte jeder, also auch Normalsichtige, ab dem 40. Lebensjahr regelmäßig zum Augenarzt gehen. Stark Kurzsichtige ohnehin, da sie dem Risiko einer Netzhautablösung ausgesetzt sind.
Ab 60 neben den Augen-Check auch auf Diabetes testen
Der Grüne Star geht mit einem zu hohen Augeninnendruck einher, so dass der Sehnerv irreparabel geschädigt wird. Es ist die zweihäufigste Ursache für Erblindung in Deutschland. Mit speziellen Augentropfen kann der Innendruck wieder gesenkt und der Schädigung des Sehnervs vorgebeugt werden. Beim Grauen Star handelt es sich um eine Eintrübung der Linse. Etwa die Hälfte aller Deutschen zwischen 52 und 64 leiden unter dem Grauen Star, häufig ohne ihn überhaupt im Alltag zu bemerken. Die Linsentrübung, auch Kataracta genannt, trifft jedoch keineswegs nur Ältere. Die größte Risikogruppe sind Diabetiker. Durch die Anreicherung von Zucker im Augenwasser quillt die Augenlinse auf, die Fasern der Linse verschieben sich und das Auge wird trüb. Ab 60 sollte daher nicht nur die Sehkraft geprüft, sondern ebenfalls auf Diabetes getestet werden. Auch die sogenannte Zuckerkrankheit beginnt langsam und vielfach unbemerkt.
Gravierender als der Grüne und Graue Star ist AMD, die altersbedingte Makuladegeneration, in deren Verlauf der Sehverlust im zentralen Gesichtsfeld zunimmt – bis hin zur Erblindung. Die Krankheit kann zwar schon in jüngeren Jahren auftreten, doch das Risiko steigt deutlich ab Mitte 60. So sind in Deutschland etwa 20 Prozent der 65- bis 74-Jährigen betroffen, darüber gar 35 Prozent. Rechtzeitig erkannt kann die Erblindung herausgezögert und in vielen Fällen sogar verhindert werden. Dennoch ist AMD die häufigste Ursache für Erblindung in Deutschland.
Langsam und gemein: AMD
Bei AMD lagern sich Stoffwechselprodukte in der Netzhaut an, die Netzhaut bildet sich zurück, wird dünner und stirbt am Ende ab. Man unterscheidet zwischen der trocknen und feuchten Makuladegeneration. Die trockene Variante schreitet sehr langsam voran, nach und nach sterben immer mehr Netzhautbereiche ab und schränken so das Sehvermögen im Zentrum des Gesichtsfeldes ein. Betroffenen beschreiben es wie eine kleine Milchglasscheibe, die Ränder bleiben weitgehend scharf, die Mitte verschwimmt jedoch. Bei der feuchten Form wachsen poröse Blutgefäße aus der Aderhaut in und unter die Netzhaut, was Schwellungen des Auges zur Folge hat. Die feuchte AMD ist seltener, führt aber deutlich schneller zur Erblindung.
Mit dem Amsler-Gitter-Test kann eine Degeneration bereits im Selbsttest frühzeitig erkannt werden. Dabei wird ein Gitter mi einem Punkt in der Mitte in einem Abstand von 40 Zentimetern vor das Auge gehalten. Erscheinen die Linie nicht gerade oder die Gitterquadrate ungleichmäßig kann das ein Hinweis auf eine Makuladegeneration sein. Die Ursachen der Erkrankung sind noch nicht vollständig erforscht. Wer direkte Angehörige mit einer Makuladegeneration hat, trägt jedoch ein höheres Risiko, ebenfalls daran zu erkranken.
Können wir die Augen durch vitaminreiches Essen unterstützen?
Unterschätzt wird vielfach, wie wichtig eine ausgewogene Ernährung für die Augen ist. Unsere Optik benötigt zur reibungslosen Funktion eine Reihe von Stoffen, die der Körper selbst nicht herstellen kann. So wirken Vitamin C und E antioxidativ und verhindern Zellschäden. Die Carotinoide Lutein und Zeaxanthin helfen, schädliches Blaulicht aus dem Spektrum der Sonnenstrahlen zu filtern. Ein Mangel an Vitamin A führt zu trockenem Auge und Nachtblindheit. Spinat, Karotten, Grünkohl sowie Süßkartoffel und Kürbis sind reich an A-Vitaminen,
Eine gute Sonnenbrille kann vor dem Erblinden schützen
Nikotin verschlechtert die Durchblutung, Blausäure im Rauch schädigt den Sehnerv. Alkoholexzesse schaden den Augen ebenso wie Vitamin-B-Mangel, der bei Alkohol- und Nikotinkonsum noch ansteigt. Der graue Star wird durch Diabetes begünstigt - und durch Sonnenstrahlung. Besonders gefährdet sind Menschen, die im Gebirge leben, denn dort ist die Sonnenstrahlung hochintensiv.
Das Risiko einer Makula-Degeneration, bei der die Stelle des schärfsten Sehens auf der Netzhaut allmählich zerstört wird, steigt durch die Menge des einstrahlenden UV- und kurzwelligen Blaulichts der Sonne. Unter dieser Alterserkrankung, die ab dem 60. Lebensjahr auftreten und zur Erblindung führen kann, leiden bereits mehr als drei Millionen Deutsche. Gute Brillengläser - nicht nur die von Sonnenbrillen - schützen vor den gefährlichen Lichtbestandteilen.
Im Gebirge sollten die Gläser mindestens 85 Prozent des UV-Lichts absorbieren, in tieferen Lagen und am Strand reichen 75 Prozent aus. Auf guten Brillen steht "UV 400", ihre Gläser absorbieren UV-Licht zu 100 Prozent. Das auf den Bügeln aufgedruckte CE-Kennzeichen und die Aufschrift EN 1836:1997 sind Kürzel, die einer europäischen Norm entsprechen und UV-Sicherheit garantieren. Zudem versichern die Hersteller durch das CE-Symbol, dass das Gestell frei von Nickel ist.
Fragwürdige Augengymnastik
Im Internet versprechen Hunderte von Seminarveranstaltern Fehlsichtigkeit durch Augengymnastik zu korrigieren. Untersuchungen haben nachgewiesen, dass ein Sehtraining weder Kurzsichtigkeit noch Altersweitsicht reduziert. Es zeigte sich zwar, dass Augen-Work-outs kurzfristig die Sehkraft verbessern. Wissenschaftler führen den Erfolg jedoch darauf zurück, dass die Gymnastik die kognitive Fähigkeit schult, unscharfe Buchstaben besser zu erraten. Es ist also ein kleinwenig wie schummeln.