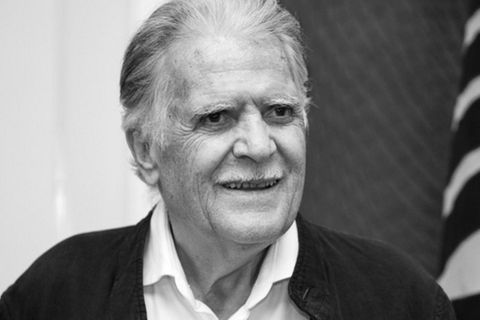Vier Oscars für den Hollywoodfilm »A Beautiful Mind« freuen nicht nur Filmfans, sondern auch Patienten und Mediziner. Denn damit ist ausgemacht, dass die Geschichte über den an Schizophrenie erkrankenden Mathematiker weiterhin viele Menschen in die Kinos locken wird. Filme wie »A Beautiful mind« und »Das weiße Rauschen« - ein Film über einen schizophrenen Jugendlichen - könnten helfen, das falsche Bild von dieser Krankheit in der Gesellschaft ein wenig zu korrigieren, glauben Fachleute.
Publikumszuspruch macht Hoffnung
Wie sehr die Öffentlichkeit an dem Thema interessiert ist, zeigte am Sonntagabend eine Veranstaltung in einem großen Frankfurter Kino. Rund 1.000 Menschen waren gekommen, um sich die beiden Filme anzusehen und über sie zu diskutieren. Der Publikumszuspruch stimmt Betroffene und Behandelnde hoffnungsvoll: »Das ist ein gutes Signal«, sagt Prof. Wolfgang Gaebel, Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie der Universität Düsseldorf und Vorsitzender des bundesweiten »Kompetenznetzes Schizophrenie«.
Filme nicht immer realistisch
Wie realistisch diese Filme sind, darüber gehen die Meinungen auseinander. Zunächst einmal sind sie sehr unterschiedlich: In »A Beautiful Mind« erscheint der Kranke als liebenswerter Sonderling, der zwischen Genie und Wahnsinn schwankt. Am Ende rettet er seine Ehe, bekommt die Krankheit in Griff und wird mit dem Nobelpreis geehrt - nicht wirklich das, was den üblichen Patienten erwartet. Das »Weiße Rauschen« ist dagegen völlig frei von jeglicher hollywoodesker Handlung. Der Film schildert die Krankheit des Stimmen hörenden und unter Verfolgungswahn leidenden Lukas wie aus dessen Kopf heraus.
Institution Psychiatrie kommt schlecht weg
Vermutlich deswegen setzen sich Betroffene, Angehörige von Erkrankten und Therapeuten eher mit dem »Weißen Rauschen« auseinander. Die Urteile darüber sind unterschiedlich: »Sehr realistisch«, lautete das Votum eines Schizophrenie-Patienten am Sonntag bei der Frankfurter Veranstaltung. »Zu stark überspitzt«, fand ihn Achim K. aus München, der für den Bundesverband Psychiatrie-Erfahrener spricht. »Feinfühlig und kenntnisreich«, urteilt Prof. Gaebel, auch wenn er als Arzt nicht ganz zufrieden ist: »Die Institution Psychiatrie kommt ja eher schlecht weg.«
Insgesamt Ermutigung
Ebenso kontrovers fällt das Urteil zu »A Beautiful Mind« aus: Der Fachmann ist skeptisch: Um der Dramaturgie des Films Willen wurde zu viel harmonisiert und geschönt, sagt Prof. Gaebel. Der Düsseldorfer Schizophreniepatient Kalle lobte den Streifen. Der Nobelpreis ist für ihn »ein Symbol, dass ein Außenseiter sich wieder einen Platz in der Welt erkämpfen kann«. Auch die Mitglieder von Kalles Selbsthilfegruppe haben den Film »Insgesamt als Ermutigung« erlebt. Trotz allen Gemäkels am Detail finden die Fachleute im Prinzip beide Filme gut: »Das ist schon ein Fortschritt, dass psychisch Kranke nicht immer Monster und Mörder sind«, sagt Prof. Gaebel.
Die 'menschlichste Krankheit'
»Das meiste, was der Volksmund über Schizophrenie weiß, ist falsch«, sagt sein Ulmer Kollege Prof. Manfred Spitzer. Dr. Jekyll und Mr. Hyde - alles Quatsch, betonte er am Sonntag bei der vom Pharmaunternehmen Lilly organisierten Veranstaltung. Als Wahrnehmungsstörung ist Schizophrenie für ihn »vielleicht die menschlichste Krankheit«. Wie schnell beim Wahrnehmen der Wirklichkeit etwas schief gehen kann, bewies er den Gästen an Ort und Stelle mit Vexierbildern und ähnlichen irritierenden Spielchen.
Abbau von Schranken?
Ob Filme aber tatsächlich helfen, die »soziale Distanz« zwischen gesunden und psychisch kranken Menschen abzubauen, ist dennoch ungewiss. Die Aktion »Open the doors«, die sich für den Abbau der Diskriminierung psychisch Kranker einsetzt, berichtet kritisch über die Folgen. So wurde bei einer Veranstaltung das Publikum vor und nach dem »Weißen Rauschen« befragt. Ergebnis: Die Zuschauer schätzten nach dem Film die Gewaltbereitschaft Schizophrener höher ein als zuvor.
Mehr Wissen führt zu Ablehnung
Damit verstärkte sich eine Tendenz, auf die auch eine Untersuchung der Universität Leipzig hindeutet. Prof. Matthias Angermeyer hatte mit Abstand von zehn Jahren Menschen nach ihrer Einstellung zu Schizophrenen befragt. Dabei zeigte sich, dass das Wissen zunimmt, aber die Ablehnung der Kranken wächst. Wollten vor zehn Jahren nur rund 20 Prozent einen Schizophrenen nicht als Kollegen haben, waren es jetzt an die 30 Prozent, ein schizophrener Untermieter käme rund 60 statt 40 Prozent der Befragten nicht ins Haus und 85 Prozent der Befragten würden einen an Schizophrenie erkrankten Menschen niemals als Babysitter akzeptieren.