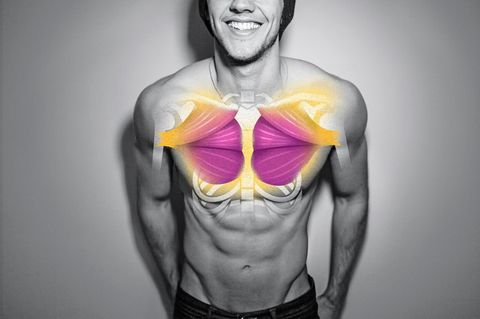Wenn John C. Martin über den Erfolg spricht, dann hört sich das so an: Es gehe darum, den Menschen zu helfen, ihre Krankheiten zu besiegen, die Welt zu verbessern. Er sagt: "Wissenschaft ist für uns das große Ding." Martin ist ein bulliger Mann mit riesigen Ohren und riesigem Doppelkinn, 64 Jahre alt, Doktor in organischer Chemie. Viele Jahre forschte er im Labor an Medikamenten, dann wurde er Manager und schrieb Geschichte: Medizingeschichte. Und: Kapitalismusgeschichte.
Als Chef der amerikanischen Biotechfirma Gilead Sciences hat er jüngst zwei Medikamente zur Behandlung von Hepatitis C auf den Markt gebracht: Sovaldi und Harvoni. Gefeiert als "medizinische Sensation" und so teuer, dass Gilead damit zur profitabelsten Firma auf Erden geworden ist. Eine einzige Sovaldi-Tablette kostet 637,70 Euro, eine Harvoni-Tablette gar 795,03 Euro. Martin selbst ist 2014, inklusive seiner Aktienoptionen, um fast 193 Millionen Dollar reicher geworden – und einer der bestbezahlten Manager aller Zeiten. Weil er Pillen verkauft, die Leben retten können – Pillen, für die Patienten und ihre Krankenkassen bereit sind, extrem hohe Preise zu zahlen. Ist das gerecht?
Es ist dies die Geschichte von ein paar Pharma-Managern aus Amerika, die unverblümt die Gesundheitssysteme der Welt plündern. Sie verletzen dabei keine Gesetze, sie sind auch keine Scharlatane – und doch hat man das Gefühl, eine Art legalen Raubzug zu erleben, der am Ende die Zukunft unserer Gesundheitsversorgung gefährdet.
Wer den Fall Gilead analysiert, wer mit Wissenschaftlern, Politikern und Krankenkassen spricht, wer Firmenunterlagen und Forschungsberichte studiert, lernt viel darüber, wie leicht sich die Unzulänglichkeiten unseres Gesundheitssystems ausnutzen lassen.
Nur wer zahlt, wird geheilt
Die Experten sind sich einig: Die beiden Hepatitis-C-Mittel, die John Martin und seine Leute verkaufen, sind hochwirksam. Sie bieten vielen der weltweit bis zu 180 Millionen Infizierten Heilungschancen von weit über 90 Prozent, bei guter Verträglichkeit. In den Jahren zuvor wurden bestenfalls Heilungsraten von gut 50 Prozent erzielt, bei gravierenden Nebenwirkungen. Jeden Tag können die neuen Pillen weit über 1000 Menschenleben retten. Diesen Triumph machen die Eigentümer nun zu Geld. Nur wer zahlt, wird geheilt. Geld oder Leben.
Für eine durchschnittliche Zwölf-Wochen-Behandlung mit Sovaldi verlangte Gilead zur Markteinführung 2013 in den USA 84.000 Dollar, ein Jahr später in Deutschland 60.000 Euro. Die Therapie mit dem Nachfolgepräparat Harvoni, das den Sovaldi-Wirkstoff mit einem weiteren kombiniert, kostete bei Markteinführung 94.500 Dollar. Krankenkassen und Politiker empörten sich über "Mondpreise". In den USA schaltete sich erstmals der Senat ein und verlangte umfassende Papiere von Martins Leuten, weil "der Preis ernste Fragen aufwerfe" . Die Politik fühlte sich erpresst. Der deutsche Gesundheitsminister Hermann Gröhe geißelte den "Missbrauch von Marktmacht zulasten der Versichertengemeinschaft". Nur ausrichten konnten die Empörten gegen die Manager aus Kalifornien wenig.
Unvorstellbare Dimensionen
Martin zeigte sich unbeeindruckt. Er bekomme Hunderte persönliche Briefe von dankbaren Patienten, erzählte er neulich. Der stern wollte mit ihm sprechen, doch seine Firma lehnte das ab, genauso wie einen Besuch der Zentrale im Silicon Valley. Fragen beantwortete Deutschland-Manager Johannes Kandlbinder. Natürlich seien Sovaldi und Harvoni hochpreisige Arzneimittel, sagt der, aber das sei angesichts dessen, dass nahezu alle Patienten erstmals in wenigen Wochen geheilt werden können, gerechtfertigt.
Anfang des Jahres einigte sich Gilead nach monatelangen Verhandlungen mit den deutschen Krankenkassen auf einen Herstellerabgabepreis von rund 41.000 Euro für eine Zwölf-Wochen-Therapie. Die Kassen zahlen inklusive Zuschlägen und Mehrwertsteuer allerdings 54.000 Euro. Auch die Verhandlungen für Harvoni sind gerade abgeschlossen: Der Herstellerabgabepreis liegt bei geschätzt 46.000 Euro. Das sind bislang unvorstellbare Dimensionen für Medikamente auf Massenmärkten.
Gilead ist profitabler als Apple
Niemals zuvor brachte ein Präparat seinen Eigentümern so schnell so viel Geld wie Sovaldi. 2014 waren es 10,3 Milliarden Dollar – die umsatzstärkste Neueinführung aller Zeiten. Und niemals zuvor gelang es Managern, so viel aus den eingesetzten Ressourcen herauszuholen. Eine Eigenkapitalrendite von über 100 Prozent und ein Nettogewinn je Mitarbeiter von gut 1,3 Millionen Euro binnen eines Jahres – das ist absoluter Weltrekord. Selbst Giganten wie Apple, Exxon oder Google kommen nicht annähernd in diese Region. Martin wurde 2014 in Amerika als "CEO of the Year" gefeiert.
Immer schon versuchten Pharmakonzerne, das maximal Mögliche aus den Gesundheitssystemen herauszupressen. Gilead jedoch perfektionierte diese Strategie über fast drei Jahrzehnte. 1987 gründete Michael Riordan das Start-up in Foster City. Er wollte mithilfe der damals ersten biotechnologischen Verfahren Medikamente gegen schwere Infektionskrankheiten entwickeln. Immer wieder überzeugte er Investoren, ihm Geld zu geben. Als Gilead 1992 mit gerade einmal 25 Mitarbeitern an die Börse ging, gab es kein einziges Produkt. Doch für die Geldgeber dieser Zeit ging die Wette auf: Bis heute haben sie ihren Einsatz mehr als vertausendfacht.
Ein wichtiger Baustein war dabei von Beginn an die große Nähe zu den Mächtigen aus Politik und Wirtschaft. Über die Jahre saßen etliche Vorstände großer Banken und Minister der republikanischen Regierungen Nixon, Ford und Bush im höchsten Aufsichtsgremium von Gilead, ebenso der spätere Verteidigungsminister Donald Rumsfeld. Zunächst lief es jedoch gar nicht gut. Nach Misserfolgen in der Forschung musste Gründer Riordan 1996 gehen. Nachfolger wurde der heutige Chef John Martin. Er machte aus Gilead eine Geldmaschine.
Erster großer Erfolg wurde ein Grippe-Impfstoff, den er an den Schweizer Roche-Konzern lizenzierte und der als "Tamiflu" anfangs für Furore sorgte. Gilead erhielt mehr als 2,6 Milliarden Dollar – die finanzielle Basis für alles Weitere. Kein einziges der für die späteren Blockbuster-Medikamente entscheidenden Moleküle stammt aus dem eigenen Haus. Martin kaufte diese bei kleinen Firmen ein.
Eine Verheißung - medizinisch und geschäftlich
Die Blaupause für Martins heutige Strategie bei Hepatitis C lieferten die Aidsmedikamente. Nach dem Fall des Eisernen Vorhangs erprobte Gilead gemeinsam mit Forschern aus Prag und dem Rega-Institut in Belgien den 1984 in Tschechien entdeckten Wirkstoff Tenofovir bei HIV-Patienten. In Kooperation mit der staatlichen University of California gelang es schließlich, die Substanz weiterzuentwickeln und sie 2001 auf den Markt zu bringen. Die Partner in Tschechien und Belgien erhielten in den folgenden Jahren jeweils etwa 60 Millionen Dollar, so ersichtlich aus Gileads Geschäftsberichten. Viel Geld für die staatlich finanzierten Institute – ein Schnäppchen für Martin. Er machte Gilead mit diesem Wirkstoff zum unangefochtenen Weltmarktführer bei HIV-Mitteln. Und mit dem Geld der Betroffenen und ihrer Versicherungen – rund 64 Milliarden Dollar bis heute – legte er richtig los. Er eroberte die noch größere Bühne: den Hepatitis-C-Markt.
Er wolle, beschrieb er damals seine Vision, nichts weniger als "eine Revolution in der Behandlung der Patienten", eine Pille, einfach und ohne Nebenwirkungen, "eben das, was Gilead schon in der HIV-Behandlung gemacht hat" . Es klang wie eine Verheißung, medizinisch und geschäftlich.
Hepatitis C ist weltweit eine der häufigsten Infektionskrankheiten, allein in Deutschland sind geschätzt 400.000 Menschen infiziert. Das Virus wird fast ausschließlich über das Blut übertragen, meist unbemerkt. Die Mehrzahl der Patienten hat sich in den 70er und 80er Jahren bei Bluttransfusionen und Massenimpfungen angesteckt. Bei manchen heilt die Krankheit von allein, bei den meisten nicht, dann drohen mitunter nach Jahren Leberzirrhose, Leberkrebs oder Tod. Ein wirksames Heilmittel, das wussten damals alle in der Pharmaindustrie, würde den Besitzer reich machen: Großer Markt plus großes Leid gleich großes Geschäft – so läuft das Business.
Sie taten alles, um den Wirkstoff möglichst teuer zu vermarkten
Wie zuvor kaufte Martin den entscheidenden Wirkstoff ein. 2011 übernahm er eine kleine Firma namens Pharmasset – sein Meisterstück. Das Unternehmen forschte unter anderem am Wirkstoff Sofosbuvir, dem heute zentralen Baustein von Sovaldi und Harvoni. Martin wollte diesen Stoff unbedingt, er zahlte 11,2 Milliarden Dollar für die 80-Mann-Firma, aus den Cashreserven. Pharmasset-Gründer Raymond Schinazi merkte dazu süffisant an: "Gute Medikamente retten Leben und haben den bedeutenden Nebeneffekt, dich reich machen zu können."
Ähnlich wie beim HIV-Wirkstoff lieferten auch bei Sofosbuvir staatlich finanzierte Forschungseinrichtungen in Europa entscheidende Grundlagen. Die Cardiff-Universität in Großbritannien und erneut das Rega-Institut in Belgien hatten in den 90er Jahren die Technologie entwickelt, mit der solche Wirkstoffe überhaupt erst hergestellt werden konnten. Für die weltweite Lizenzierung ihrer Technologie erhielten die Forscher von verschiedenen Firmen bis Ende 2007 überschaubare 3,6 Millionen Euro. Martin ging es nie um Millionen, sondern um Milliarden. Seine Spezialisten taten alles, um den Wirkstoff möglichst teuer zu vermarkten. Ein 2011 noch für Pharmasset im Rahmen der Verkaufsverhandlungen erstelltes Gutachten der Investmentbank Morgan Stanley ging von einem realistisch zu erzielenden Abgabepreis von 36.000 Dollar in den USA und rund 20.000 Euro in der EU aus. So könne man bis zum Ablauf des Patentschutzes im Jahr 2029 über 87 Milliarden Dollar einnehmen, hieß es. Martin und seinen Leuten reichte das nicht. Sie setzten am Ende mehr als doppelt so hohe Preise durch – und erschlossen damit ein Potenzial von mehreren Hundert Milliarden Dollar. Wie war das möglich?
Gerechtfertigte Preise sehen anders aus
Normalerweise bilden sich Preise frei nach Angebot und Nachfrage. Bei Arzneimitteln ist das anders. Patienten, die von schwerer Krankheit bedroht sind, klammern sich an jedes Heilsversprechen und können erheblichen Druck auf Krankenkassen und Politiker ausüben. Das bringt die Hersteller in eine gute Position. Ein gerechter Preis sollte die Not der Patienten und Kassen nicht ausnutzen und gleichzeitig den Hersteller für das eingegangene Risiko zur Erforschung des Medikaments belohnen. Ein gerechter Preis müsste sich also an den wahren Kosten orientieren, ergänzt um eine Gewinnmarge. So ist es im Fall Gilead aber nicht.
Die reinen Produktionskosten für Sovaldi und Harvoni lassen sich leicht abschätzen. Nach einer Studie der Universität Liverpool kosten die Sovaldi-Tabletten für eine Zwölf-Wochen-Therapie in der Massenherstellung maximal 136 Dollar, Harvoni maximal 250 Dollar. Die Vertriebskosten kann man mit rund 50 Dollar ansetzen. Schwierig dagegen ist es mit den Forschungsund Entwicklungskosten, die in der Pharmaindustrie traditionell den größten und undurchschaubarsten Block ausmachen. Gilead selbst gibt auf Anfrage keine Zahlen dazu heraus, es seien "interne Unternehmenskennzahlen", heißt es.
Um die Entwicklungskosten trotzdem abschätzen zu können, hat der stern sämtliche Jahresberichte der vergangenen 25 Jahre und die verfügbaren Berichte der über ein Dutzend erworbenen Pharmaunternehmen analysiert. Die übernommene Firma Pharmasset etwa hatte die spezifischen Forschungsausgaben für den Wirkstoff Sofosbuvir bis 2011 mit insgesamt 62,5 Millionen Dollar angegeben. Gilead führte nach der Übernahme die Zulassungsstudien fort, an denen 1947 Probanden teilnahmen. Bezieht man zusätzlich die Forschungsmisserfolge auf dem Weg zur fertigen Pille ein, ergeben sich maximal vertretbare Entwicklungskosten von rund 620 Millionen Dollar für Sofosbuvir.
Gewinnversprechen für wenige – die wir als Gesellschaft alle bezahlen
Umgelegt auf die weltweit rund 500.000 Personen, die bis Ende 2015 mit Sovaldi und Harvoni behandelt sein werden, und ergänzt um die Produktions- und Vertriebskosten kommt man so auf Gesamtkosten von rund 1500 Dollar für eine Zwölf-Wochen-Therapie. Gilead erhält in Deutschland aber 41.000 und 46.000 Euro – mehr als das 30-Fache. So reichte schon das bisher nur von den deutschen Kassen bezahlte Geld aus, um die Entwicklungskosten vollständig zu decken.
Wären ähnliche Aufschläge auch in anderen Branchen durchsetzbar, würde ein Liter Milch beispielsweise 18 Euro, ein hochwertiges Smartphone 10.000 Euro kosten. Himmlische Gewinnversprechen für wenige – die wir als Gesellschaft alle bezahlen.
So verwundert es nicht, dass sich gesetzlich Versicherte derzeit mal wieder auf Beitragserhöhungen einstellen müssen. 2014 stiegen die Arzneimittelausgaben um zehn Prozent, im ersten Halbjahr 2015 um weitere gut sechs Prozent. Rund 500 Millionen Euro machten in diesen sechs Monaten allein die neuen Hepatitis-C-Medikamente aus. Etwa drei Prozent der Arzneimittelausgaben für circa 0,014 Prozent der Versicherten. In solidarischen Versicherungen kommt die Gemeinschaft für die teuren Notfälle auf. Was aber, wenn der Notfall zum Normalfall wird? Können wir uns das dann noch leisten?
Gute Medizin wird in Europa wieder zur Klassenfrage
Wegen der erwarteten Kosten wurde Sovaldi in der Schweiz und in Frankreich nur schwerstkranken Patienten bezahlt, anders als in Deutschland. Und in fast allen Ländern Osteuropas ist es sogar so, dass die Sozialversicherungen gar nicht zahlen. Die Kranken müssen sich die Pillen selbst kaufen – wenn sie denn können. Gute Medizin wird in Europa wieder zur Klassenfrage.
"Nicht erpressen lassen!"
So weit soll es in Deutschland nicht kommen. Früher konnte die Industrie die Preise frei wählen, ohne Limit. Seit 2011 darf sie das nur noch im ersten Jahr, danach muss sie sich mit den Krankenkassen einigen. Und die, so die Hoffnung, sollen die Preise mithilfe von Studien zum konkreten Nutzen der Medikamente herunterhandeln.
Antje Haas, die Leiterin der Abteilung Arzneimittel beim Spitzenverband der Krankenkassen, empfängt in einem nüchtern gehaltenen Konferenzraum in Berlin-Mitte. Weiße Stühle an zusammengeschobenen weißen Tischen, die ein so riesiges Rechteck bilden, dass es nahezu unmöglich ist, sich darüber hinweg die Hand zu geben. Hier wird über die Milliarden der Versicherten entschieden. Haas hat maßgeblich auch die Sovaldi- und Harvoni-Preise ausgehandelt, fünf ihrer Leute saßen fünf Gilead-Leuten gegenüber. Was konkret besprochen wurde, darf sie nicht verraten. Doch was sie allgemein zum Ablauf solcher Treffen sagt, erzählt genug.
Die Hersteller sind keine Rechenschaft schuldig
Von der Politik ist ihr ein enger Rahmen vorgegeben, worüber sie mit den Managern verhandeln darf und worüber nicht. So ist es gesetzlich nicht vorgesehen, die wahren Kosten des Herstellers für Produktion, Forschung und Entwicklung überhaupt in die Kalkulation einzubeziehen. Wie man da einen fairen Preis erzielen soll, weiß Haas auch nicht. Die Bundesregierung habe zuletzt sogar wichtige Grundlagen zur Nutzenbewertung von Medikamenten zurückgenommen. Zudem "wäre es sicherlich hilfreich" , wenn die Hersteller plausible sowie vollständige Preise aus den Nachbarländern nennen müssten, und zwar "keine künstlich hochgehaltenen Referenzgrößen", klagt Haas. Müssen sie aber nicht.
Im Fall Gilead saß ihr Johannes Kandlbinder gegenüber, Verhandlungsführer der Amerikaner und einer der obersten Manager in Deutschland. "Die Verhandlungen waren nicht einfach." Man stritt um Zusatznutzen, Komparatorpreise, europäische Vergleichspreise, Effizienzgrenzberechnungen, Innovationsgrad, Größe der Patientenpopulation, jede Seite gerüstet mit Details aus einer undurchsichtigen Datenwelt. Kandlbinder sagt, Sovaldi und Harvoni seien zwar hochpreisig. "Aber sie sind nicht teurer als die früheren Präparate, wenn man die Heilungskosten anschaut." Worauf er anspielt: Eine herkömmliche Interferontherapie kostet auch 10.000 bis 20.000 Euro, sie wird oft abgebrochen, muss wiederholt werden, es drohen Klinikaufenthalte, weitere Ansteckungen, Transplantationen, alles teuer. Gileads Präparate dagegen heilen die Kranken innerhalb weniger Wochen. Er habe in den Gesprächen geschaut, "dass ein verhandelter Preis den Mehrwert des Produkts widerspiegelt", sagt Kandlbinder. Es gehe dabei nicht um die tatsächlichen Kosten, sondern um das Marktumfeld. Was kosten Vergleichstherapien, wie ist ein neues Präparat einzuordnen?
"Eine Gesellschaft darf sich nicht erpressen lassen"
Ein atemraubend rasanter Poker. 1998 wurden für eine Zwölf-Wochen-Therapie mit dem damals neuen Hepatitis-C-Mittel Rebetol 2500 Dollar verlangt. Bei jeder späteren Innovation stieg der richtungsweisende US-Einführungspreis: 6000, 35.000, 50.000, 66.000, 84.000 und zuletzt 94.500 Dollar. Gileads Preise sind nun der Maßstab aller künftigen Verhandlungen. Darin liegt die enorme Sprengkraft. Gesundheitspolitiker wie Kathrin Vogler von den Linken sprechen von einer "tickenden Zeitbombe".
Die immensen wissenschaftlichen Fortschritte in Biotechnologie und Gentechnik werden in den kommenden Jahren wahrscheinlich weitere "Wunderpillen" hervorbringen. Für Krebs, vielleicht Diabetes oder Alzheimer. Das ist gut – nur leider bald schon nicht mehr bezahlbar. Für den Gesundheitsökonomen Jürgen Wasem stellt sich darum "die Systemfrage", wie er sagt. "In naher Zukunft werden mehr und mehr hoch wirksame Medikamente zur Verfügung stehen, die unsere Krankenversicherungssysteme gegen die Wand fahren lassen, wenn diese nach dem Modell Gilead entlohnt werden sollen."
"Eine Gesellschaft darf sich nicht erpressen lassen", sagt auch Josef Hecken. "Wir müssen sagen: Stopp, bis hierhin und nicht weiter." Der Chef des Gemeinsamen Bundesausschusses ist einer der mächtigsten Männer im System. Sein Gremium bewertet den Nutzen neuer Medikamente, wonach sich dann der spätere Preis richtet. Hecken sagt: Nur mit schärferen Bewertungen ließen sich die Preise künftig senken. Im Fall Gilead hat das nicht geklappt.
Bei Sovaldi hatte sein Gremium einen "beträchtlichen Zusatznutzen" festgestellt, ein hoher Preis sei also zu rechtfertigen, sagt Hecken. "Ob der aktuelle Preis ethisch verantwortbar ist, wage ich aber zu bezweifeln."
Bleibt also nur der Wettbewerb. Angesichts der Gewinnmargen müssten eigentlich Konkurrenten auftauchen. Und tatsächlich stehen einige Hersteller bereit. Abbvie hat sogar schon ein Produkt auf den Markt gebracht. Das Unternehmen verlangte zur Markteinführung: 83.319 Dollar – gerade einmal 681 Dollar weniger als Gilead.
Wettbewerb? Tut nicht Not
Ein Grund für diesen sehr zurückhaltenden Preiskampf könnte in den Eigentümerstrukturen der Hersteller liegen. Unter den Hauptaktionären aller relevanten Firmen im Hepatitis-C-Markt finden sich die immer selben sieben Namen: die Vermögensverwalter Blackrock, Vanguard, State Street, Fidelity, Capital Group, Wellington und T. Rowe Price. Im Schnitt vereinen diese Riesen um die 30 Prozent der Firmenanteile. Echter Wettbewerb liegt nicht in ihrem Interesse. Bei ihnen werden weiter große Summen aus unseren Gesundheitssystemen landen.
John Martin und seine Leute haben übrigens längst neue Rekorde angekündigt. Im ersten Halbjahr stieg der Gewinn, trotz inzwischen geltender Preisrabatte, nochmals um 50 Prozent. Vor allem in Europa hoffen sie auf noch höhere Einnahmen, dank Harvoni. Auf einer Konferenz stellte einer der Investoren eine merkwürdig zynische Frage: Bei HIV, sagte er, da dauerten die Therapien Jahrzehnte, mit den wirksamen Hepatitis-Mitteln aber nur wenige Wochen – ob man in dieser Zeit denn genug Geld verdienen könne? Ja, entgegneten die Gilead-Bosse, es gebe ja genug Kranke.
Außerdem wollen sie ja weiter, so hat es Martin verkündet. Viel weiter. Zu neuen Wirkstoffen. Nach Hepatitis C will er auch etwas gegen Hepatitis B finden, daran leiden noch mehr Menschen. Und Aids möchte er auch heilen können. Sie hätten "Appetit, noch mehr Dinge für noch mehr Patienten auf der Welt zu tun" . Für die Krankenkassen und ihre Beitragszahler muss das fast wie eine Drohung klingen.