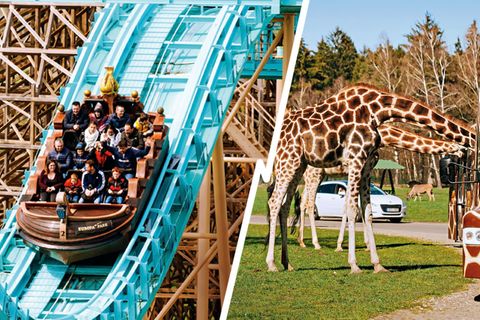Es war die Wiege des deutschen Films, doch Traumfabrik durften die Studios von Potsdam-Babelsberg nur die kürzeste Zeit sein. Schon elf Jahre nach ihrer Gründung zog 1933 auch bei der damaligen Ufa der braune Propagandageist ein. Nach dem Zweiten Weltkrieg übernahm mit der Defa die SED die Regie, seit 1989 wiederum bestimmte vor allem der wirtschaftliche Überlebenskampf den Drehplan. Trotz allem sind auf dem weitläufigen Gelände vor den Toren Berlins mehr als 3.000 Filme entstanden. Die prägendsten und erfolgreichsten davon stellt seit Freitag die neue Dauerausstellung des Filmmuseums Potsdam vor.
Entwicklung ab 1945 im Mittelpunkt
"Babelsberg - Gesichter einer Filmstadt" heißt die Schau, in deren Mittelpunkt auf 450 Quadratmetern im historischen Marstall-Gebäude die Produktionen der Defa stehen. "Sonst ist beim Thema Babelsberg meist von Ufa und Glamour die Rede, aber das waren ja nur elf der insgesamt 82 Jahre Filmgeschichte hier", sagt Museumsdirektorin Bärbel Dalichow.
Entsprechend werden die Jahre zwischen 1922 und 1945 nur kurz am Eingang abgehandelt. Einige Requisiten stehen dort, kurze Texte erinnern an Ufa-Erfolge wie "Metropolis" und "Die Nibelungen" von Fritz Lang, die längst genauso wie Marlene Dietrichs Auftritt in "Der blaue Engel" Filmgeschichte sind. Die Ausstellung an sich aber widmet sich mit Informationen, Plakaten, Szenenfotos und reichlich Filmausschnitten den Jahren ab 1945.
Mehr Infos im Netz
"Wir präsentieren die Filme im Spiegel ihrer Zeit", erläutert Dalichow, weshalb parallel auf die zeithistorischen Ereignisse hingewiesen wird. Defa-Mitgründer Kurt Maetzig, selbst Regisseur zahlreicher Filme, verwies auf den Anspruch der DDR-Filmemacher: "Wir wollten die Wirklichkeit in unsere Filme holen und dabei selbst wieder auf die Wirklichkeit Einfluss nehmen."
"Kalter Krieg" auch im Film
Wie selten dies gelang, wird beim Gang durch die Ausstellung klar. Der Aufbruchsgeist der ersten Jahre verflog schnell. 1946 hatte Wolfgang Staudte bei der Defa mit "Die Mörder sind unter uns" noch den ersten deutschen Nachkriegsfilm gedreht. Schon im folgenden Jahr thematisierte Maetzig in "Ehe im Schatten" erstmals die Judenverfolgung - den Film sahen damals in allen vier Besatzungszonen zwölf Millionen Zuschauer.
Doch spätestens seit dem gescheiterten Volksaufstand vom 17. Juni 1953 wollten die SED-Funktionäre stets mit am Drehbuch schreiben. Mit dem aufkommenden Kalten Krieg verlegte sich das DDR-Studio auf die Inszenierung einer heilen Welt, wie sie auch für das frühe Kino der Bundesrepublik typisch war. Im Westen feierten Peter Alexander und Luis Trenker Publikumserfolge, im Osten strömten die Zuschauer zu Schmonzetten wie "Eine Berliner Romanze" oder "Meine Frau macht Musik".
Märchen als Ausweg aus der Propagandafalle
Als Ausweg aus dem verordneten Kitsch entdeckten frustrierte Defa-Regisseure in dieser Zeit den Märchenfilm. Legendär ist bis heute "Der kleine Muck", auf diesem Gebiet erarbeitete sich das Babelsberger Studio auch international Respekt. Mit Propagandaschinken wie "Anflug Alpha 1" über eine NVA-Fliegerstaffel sorgte die Defa dagegen ab Mitte der sechziger Jahre zunehmend auch beim heimischen Publikum für Langeweile.
DDR-Glanzpunkt: "Jakob, der Lügner"
Allein dem beharrlichen Kampf einiger Regisseure war es zu danken, dass das DDR-Kino trotz allem zu etwas internationalem Ruhm gelangte. Frank Beyers "Jakob der Lügner", die Verfilmung des Jurek-Becker-Romans über einen Juden im KZ, der den Mithäftlingen mit fingierten Radiomeldungen Hoffnung auf Befreiung macht, war 1977 der einzige DDR-Film, der jemals für einen Oscar nominiert wurde. Konrad Wolfs "Solo Sunny" erhielt 1979 auf der Berlinale im damaligen Westteil der Stadt den Silbernen Bären, und Heiner Carows Liebesromanze "Die Legende von Paul und Paula" von 1973 lief bis 2002 täglich in einem Berliner Kino.
"Filmgeschichte in allen Facetten"
"Ich habe viele Erinnerungen in der Ausstellung wiederentdeckt", sagt Regisseur Maetzig. Genau dies war Anliegen des Museums. "Wir wollen die Babelsberger Filmgeschichte in allen Facetten zeigen", erklärt Leiterin Dalichow. "Jeder soll etwas finden, ob er sich nun für die alten Plakate und Kostüme interessiert oder in unserer Datenbank mit allen bisherigen Produktionen recherchieren will."