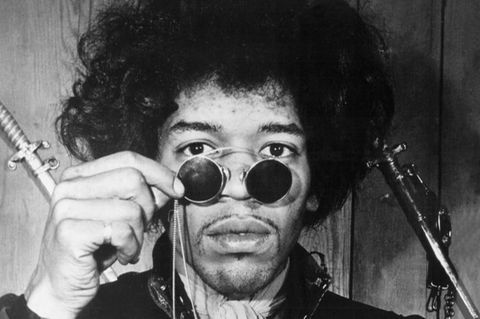Wie kamen Sie auf die Idee, deutsches Volksliedgut in neuem klanglichen Gewand aufzunehmen?
Ich komme von der Folkmusik. Ich habe Anfang der 70er Jahre irischen Folk gespielt, dann wurde ich Liedermacher. Mit dem Folkduo Schnappsack bin ich durch Europa gezogen, das lässt einen ein Leben lang nicht mehr los.
Haben Sie damals auch schon deutsche Lieder gespielt?
Ja, Schnappsack hat ausschließlich deutsche Lieder und Tänze gespielt. Auch im Ausland: in Luxemburg, Frankreich, Belgien, Dänemark. Überall, wo es damals schon ein Podium für deutsche Folkmusik gab.
Waren Ihre Mitstreiter überrascht, als Sie sie auf das Projekt Schöne Weile angesprochen haben?
Ich habe George Kranz über die Jahre immer wieder auf dieses Projekt angesprochen. Vor eineinhalb Jahren kam er auf einmal auf mich zu und hat sich einverstanden erklärt. Die Zeit musste dafür reif werden.
Wieso ist die Zeit gerade jetzt dazu reif?
Ich habe meinen Kollegen Platten aus Frankreich, Italien, Irland und Belgien vorgespielt, wo moderne Volksmusik längst in die tägliche Poplandschaft gehört. Danach haben die gesagt: Ja, das wollen wir auch mal probieren. Generell glaube ich, dass es in der immer globaler werdenden Welt in jeder Nation ein natürliches Bedürfnis nach nationaler Identität gibt. Das hat gar nichts mit Nationaltümelei zu tun. Europa hat unterschiedliche kulturelle Wurzeln. Und ich glaube, dass es für ein organisches Zusammenwachsen sehr wichtig ist, dass man neben der Toleranz den anderen europäischen Ländern gegenüber seine eigene nationale Identität behält und sie mit einbringt.
Das Projekt:
Es klingt alles andere als alltäglich, was die Berliner Band Schöneweile präsentiert: Hier trifft das klassische deutsche Volkslied auf zeitgemäßen Pop. Hiter dem Projekt steckt Folk-Urgestein Peter Braukmann, der gemeinsam mit der Drummer-Legende George Kranz eine Konstellation von Musikern zusammen geführt hat, deren Stil der alten deutschen Volksmusik ein Denkmal setzt und sie gleichzeitig ins Jetzt überführt. Aus dem riesigen Fundus deutscher Volkslieder traf Braukmann eine Auswahl heute noch bekannter Melodien. Mit Songs wie "Der Mond ist aufgegangen", "Dass du mein Liebster bist" oder "Die Gedanken sind frei" wollen Schöneweile das alte Liedgut wieder dem öffentlichen Bewusstsein präsent machen. Die Stücke wurden so arrangiert, dass gleichberechtigt Traditionelles wie Schalmei, Krummhorn, Knopf-Akkordeon oder deutscher Dudelsack neben den "klassischen" Rockinstrumenten Gitarre, Bass, Keyboards und Drums steht. Am 12. Mai erscheint nun ihr Album "Schöneweile Vol. 1". In dem Zusatz "Vol. 1" steckt schon die Ankündigung einer Fortsetzung. Braukmann/Kranz haben das Projekt langfristig angelegt. Auch live will die Gruppe ihre Vorstellung von zeitgemäßer Volksmusik nahe bringen. Geplant ist eine Bühnenshow. Dabei soll die Ballade von den Königskindern als Rahmenhandlung dienen, um vom deutschen Volkslied zum Volkstanz und zurück zu gelangen.
An wen richtet sich Ihre Musik?
Ich glaube, dass bei der Generation ab 45 aufwärts das Bedürfnis nach einem anderen Programm und nach einem anderen Medienangebot da ist als das, was wir jeden Tag im Radio und Fernsehen wahrnehmen. Bei Jüngeren ist es einfach eine Frage, was man ihnen anbietet. Das gilt auch für jüngere Hörer. Wir haben nach unserem Auftritt im MDR in der Schlagerparade viele Zuschriften von jungen Hörern bekommen, 18-Jährige, die unsere Volkslieder noch nicht kannten und toll fanden. Es gibt im deutschen Liedgut viele schöne Melodien und Lieder, die ein breites Publikum ansprechen können. Das Problem ist letztendlich der Multiplikator, damit meine ich die Skepsis und auch Angst von Medienredakteuren, über Ungewöhnliches zu berichten, das nicht ins Format zu passen scheint.
Woran liegt es, dass die Deutschen ein gebrochenes Verhältnis zu ihrer Volkskultur haben - im Gegensatz zu Ländern wie England oder Irland? Liegt das nur an dem Nationalsozialismus?
Das hat natürlich auch damit zu tun. Nach dem Krieg hat die große Adaption amerikanischer Musik dazu geführt, dass sich die Deutschen bewusst von dem abgewandt haben, was ihnen zwölf Jahre lang vorgesetzt wurde. Das ist eine verständliche und notwendige Gegentendenz gewesen. In den 60er Jahren hat es mit der Waldeck-Bewegung um Reinhard Mey, Katja Epstein oder Hannes Wader einen ersten Versuch gegeben, das deutsche Liedgut wieder zu beleben. Das hatte großen Einfluss auf die deutsche Folk-Bewegung der 70er Jahre. Damals gab es in jedem Kaff in Deutschland einen Jugendclub, in dem Blues, Jazz und deutsche Folkmusik gespielt wurde. Dass das versandet ist, hat mit der Ideologisierung zu tun, mit der wir das damals betrieben haben.
Was meinen Sie mit Ideologisierung?
Die deutsche Volksmusik war für uns eine Musik, die in der deutschen Arbeiterbewegung und im Mittelalter begründet war. Es war damals unmöglich, mit Ernst Mosch oder Heino auf einer Bühne zu stehen. Damals herrschte eine große Intoleranz gegenüber Schlager-Sängern. Das war meiner Meinung nach ein riesiger Fehler. Wir hätten Heino damals singen lassen und die Auseinandersetzung aufnehmen müssen. Dann hätte es eine andere Entwicklung gegeben. Denn dann hätte man auch Menschen erreicht, die nicht ins Jugendzentrum gehen. Aber darin liegt heute die Chance: Wir können bei Florian Silbereisen oder bei "Aspekte" auftreten. Die Menschen entscheiden, welche Musik sie mögen und welche zu ihrem täglichen kulturellen Gebrauch wird. Das können sie aber nur, wenn ihnen die Musik angeboten wird.
Die Mitglieder von Schöneweile:
Peter Braukmann (Vocals, Knopfakkordeon, Bouzouki) - Ex-Folkmusiker (Schnappsack), Produzent (Else Stratmann, Gerd Dudenhöffer), TV-Produzent (Monty Python etc.), geistiger Vater von Schöneweile
George Kranz (vocals / drums) - Berliner Trommler, dessen Hip-Hop-Hymne "Din Daa Daa" 1983 Clubhit avancierte. Co-Komponist des Musicals "Linie 1", festes Mitglied beim GRIPS Theater.
Beathoven (Keyboards, Piano) - Ex-Mitglied der DDR-Band Rockhaus, derzeit wieder auf Reunion-Tour
Michael Brandt (Gitarre) - Studiomusiker, spielte bei Klaus Hoffmann, festes Mitglied des Berliner GRIPS Theaters
Cathrin Pfeifer (Akkordeon) - Weltweit geschätzte Instrumentalistin, Projekte mit JAMS, Topo Gioia, Ahava Raba uvm.
Axel Kottmann (Bass) - Ex-Zeitgeist, langjähriger Weggefährte von George Kranz, fester Musiker beim GRIPS Theater
Christoph Pelgen (Dudelsack, Flöten) - der wohl beste deutsche Dudelsackspieler. Zahlreiche Studioproduktionen, zudem bei der französischen Folklore-Formation Marmotte.
Als Vokalisten/innen wirken mit:
Manja Doering, Ester Daniel
und
Jens Mondalski
, allesamt feste Ensemble-Mitglieder des GRIPS Theaters
Warum haben Sie die Lieder klanglich aktualisiert? Wäre nicht ein "historisches" Instrumentarium angemessener?
Die Zeit ist heute eine andere, und die Musik hat sich gewandelt. Ich habe die Lieder alle schon einmal historisch aufgearbeitet. Darüber bin ich weg. Mit Schöne Weile wollen wir diese Musik modern spielen und dadurch mehr Menschen erreichen, als wenn wir puristisch spielen würden.
Was können heutige Menschen von Texten wie "Lauf, Müller, lauf" oder "Mudder witsch" mitnehmen?
Genauso viel wie mit "Da,da, da". Der Inhalt ist für mich sekundär. Ich will mich auch nicht hinstellen und belehrend erläutern, welchen Ursprung ein Lied wie "Lauf, Müller, Lauf" hat. Ich finde, das ist ein lustiges Lied, einen anderen Ansatz habe ich dabei nicht. Mit Liedern wie "Der Mond ist aufgegangen" oder "Die Gedanken sind frei" gibt es durchaus Lieder auf der CD, die heute die gleiche Gültigkeit haben wie vor 100 Jahren. Wir wollen, dass die Menschen die Lieder dieser CD wiederentdecken, und haben uns auf zehn Lieder geeinigt, von denen wir glauben, dass sie einen sehr hohen Wiedererkennungs-Charakter haben, weil sie in der Schule, im Kindergarten oder in der Musikschule gesungen wurden. Wir gehen davon aus, dass beim Hören ein Aha-Erlebnis eintritt.
In den letzten Jahren gibt es einen Trend, dass sich die Deutschen wieder stärker für ihre eigene Kultur interessieren. Woran liegt das?
Das ist ein globaler Prozess. Wir haben es in den letzten zehn Jahren weltweit durch die wachsende Monopolisierung von Wirtschaftsapparaten mit einer Monokultur zu tun. Und wir haben es mit einer Wirtschaftsstruktur zu tun, die über Kommunikationsmedien funktioniert, die sich nicht durch Inhalt und Qualität, sondern durch Quantität ausdrückt. Das führt entweder zu Dekadenz und Zusammenbruch, oder dazu, dass Menschen sich fragen: Ist da nicht noch ein bisschen mehr? Ich glaube, dass ganz vielen Menschen etwas fehlt, wo sie sich zu Hause fühlen können. Der Begriff Heimat hat schon eine gewisse Funktion. Wenn man nicht weiß, wo man herkommt, weiß man auch nicht, wo man hin will.
Interview: Carsten Heidböhmer