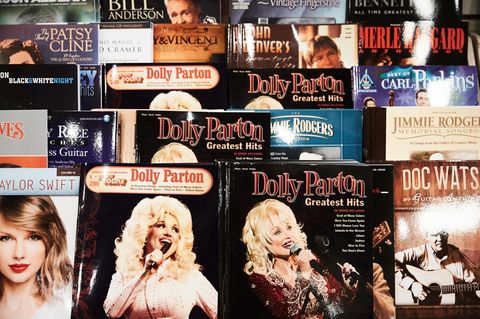Die Objekte der Begierde tragen Namen wie Roboter in Science-Fiction-Filmen: LC4, B 15, Nr. 670, SE 42. Aber diese schlichten Seriennummern erzielen auf Auktionen und im Handel stolze Preise. SE 42 ist für 1200 Euro das Paar zu bekommen, je nach Zustand; B 15 kann bis zu 7000 Euro kosten. Die Rede ist nicht von Maschinen, sondern von Möbeln. Möbeln, die Geschichte machten. Denn hinter diesen Nummern verbergen sich große Designer-Namen: Bei B 15 etwa handelt es sich um eine Liege von Marcel Breuer, die er 1930 für den Möbelhersteller Thonet entwarf; Nr. 670 ist ein Lounge-Sessel aus Palisanderholz und schwarzem Lederbezug, den das amerikanische Ehepaar Charles und Ray Eames Mitte der 50er schuf. SE 42 steht für einen Stuhl des Architekten Egon Eiermann, und LC4, eine Chaiselongue mit Fellbezug, stammt von Le Corbusier.
Heute steht in fast jedem deutschen Haushalt mindestens ein eigenhändig geschraubtes Möbel mit skandinavischem Namen, eine Uniformierung der Innenräume ist die Folge. Eine Gruppe von Kennern und Ästheten will dagegenhalten, sucht nach Möbeln, die eine "eigene Designsprache" haben, wie Frank Anger-Lindemann sagt. Der ist Möbelhändler in Hamburg und Mitglied in der bundesweiten Vereinigung "Creative Inneneinrichter" - einem Verbund von ungefähr 50 Einrichtungshäusern mit einem gemeinsamen Interesse. "Guter Geschmack", wie Anger-Lindemann sagt. "Unsere Möbel sind der klassischen Moderne verschrieben, sie sind ebenso puristisch wie minimalistisch."
Und etwas teurer als der Rest.
Da Hersteller wie Cassina, die Sessel, Sofas und Liegen von Le Corbusier neu aufgelegt haben, nicht nur Wert auf genaueste Wiederherstellung der Originale legen, sondern auch eine Lizenzgebühr an die Le-Corbusier-Stiftung zahlen müssen, setzen ihre Preise an bei über 3000 Euro. Daher sind diese Möbel überwiegend in Kanzleien, Werbeagenturen und Chef-Büros zu finden. "Wer sich darstellen möchte, greift zum Klassiker", sagt Anger-Lindemann. "In manchen Firmen sind Möbel auch Sinnbilder für den Karriereanstieg." Sinnbilder mit Strahlkraft. Mittlerweile verlangen auch immer mehr Privatkäufer nach einem Le Corbusier, dem Sessel LC2 etwa, oder nach einem "Barcelona"-Sessel von Mies van der Rohe, weil sie diese Möbelstücke in Hochglanzzeitschriften und Fernsehproduktionen gesehen haben.
Die beliebtesten Klassiker stammen aus der Bauhaus-Zeit, den späten 20er Jahren, einer kurzen Epoche mit anhaltend kraftvollem Einfluss. In dieser Zeit entwarf Marcel Breuer den ersten Stuhl aus Stahlrohr, den B3. Stahlrohr hatte den Vorteil, beständig und zugleich preisgünstig zu sein, und entsprach damit dem Wunsch der Bauhaus-Vordenker, funktionelle Möbel für die Massen herstellen zu können. Das genau war für sie die Kunst: Sie wollten das bürgerlich Individuelle durch eine moderne Mengenanfertigung überwinden. Der Architekt Le Corbusier folgte dieser Idee, seine Stahlrohrmöbel waren gedacht als Elemente der nüchternen "Wohnmaschine" - so taufte der Schweizer einen Hausentwurf. Die Architektin Eileen Gray schuf einen Tisch aus Stahlrohr und Glas (Name: E-1027), der Metallarbeiter Wilhelm Wagenfeld kreierte die Tischleuchte MT9. Alle diese Möbelstücke sind heute Teil des Design-Kanons; in ihrer Zeit jedoch erreichten sie nicht, wie gedacht, die Massen, sondern nur eine informierte Elite.
Die Machtergreifung Hitlers
unterbrach das Bauhaus-Experiment dann vollends. Es wurde in anderen Ländern weitergeführt, unter anderen Namen, von anderen Designern. In Amerika entwarf das Ehepaar Charles und Ray Eames von den 40er Jahren an Möbelstücke mit klarer Geometrie, sie formten Sperrholz in Kurven und waren die Ersten, die den Werkstoff Fiberglas in der Möbelproduktion einsetzten. Neben dem Armlehnstuhl DAR aus Fiberglas ist am stärksten der Lounge-Sessel Nr. 670 mit Polsterschemel Nr. 671 in Erinnerung geblieben. Beide machen sich ausgezeichnet vor jedem Kaminfeuer.
Die Ideen der Eames inspirierten auch skandinavische Designer. In den 60ern schuf der Finne Eero Aarnio Fiberglasmöbel im Raumfahrtlook, am prominentesten ist sein Sessel "Ball". Auch die Werke des Dänen Arne Jacobsen lassen sich zu den Folgen von Bauhaus rechnen: Jacobsen betrachtete sein Schaffen als Gesamtkunstwerk, und als er 1956 den Auftrag erhielt, das Royal Hotel in Kopenhagen komplett zu gestalten, dachte er sich für das Interieur die klassisch gewordenen Stühle "Schwan" und "Ei" aus.
Im Heimatland des Bauhauses
ging es nach dem Krieg ebenfalls weiter mit Purismus: Egon Eiermann, der Architekt des Langen Eugen in Bonn, entwickelte in den 50ern Wannenstühle aus Rattan sowie Sperrholzmöbel wie den Klappstuhl SE 18. "Wer sich damals einen Eames kaufte, galt als Avantgardist", sagt Möbelhändler Anger-Lindemann. Oder war schlicht ahnungslos. So wie die Großmutter des Schauspielers Steffen Wink, die in den 50er Jahren für die Amerikaner in Wiesbaden arbeitete und von einem Kollegen einen Stuhl geschenkt bekam, der ihren Enkel faszinierte: "Er stand im Nähzimmer, und ich machte auf ihm meine Hausaufgaben", sagt Wink. Als seine Großmutter in eine kleinere Wohnung zog, gelang es ihm, ihr den Stuhl abzuschwatzen, ohne zu wissen, dass er sich eine kleine Kostbarkeit zu Eigen machte: Es war ein Cherner Armchair aus dem Jahr 1958, ein weiterer Klassiker der amerikanischen Moderne. "Auf Auktionen bringt dieser Stuhl heute mehr als 2500 Euro", weiß Wink jetzt - aufgeklärt durch einen Freund, der sich mit Möbelklassikern auskennt.
Steffen Wink hat den Stuhl von Norman Cherner vor einem Schicksal bewahrt, das nicht wenigen Design-Klassikern widerfährt: Sie landen in Kellern, in Speichern oder gar auf dem Sperrmüll. "Wir bekommen oft Fotos von Möbeln, die auf Dachböden gefunden werden", sagt Askan Quittenbaum, Inhaber des gleichnamigen Auktionshauses in München. Quittenbaum veranstaltet zweimal im Jahr Auktionen zum Thema "Modernes Design". Im Angebot sind jeweils Originalstücke aus den 20er bis zu den 70er Jahren. Zu diesen Auktionen reisen Sammler, die auf der Jagd nach Raritäten sind und die für eine Würfel-Studie von Naum Slutzky aus der Bauhaus-Zeit schon mal 18000 Euro zahlen.
Für diese Käufer erhalten Möbel den Rang eines Kunstwerks, "vor allem, wenn sie in Kleinstserien gefertigt wurden", wie Quittenbaum sagt. Eine wachsende Zahl von Bietern finde sich bei Jüngeren. "Manchmal kann man bei uns Kulturgüter zu Ikea-Preisen erwerben", so der Auktionator. Ein Stuhl von Egon Eiermann etwa sei noch günstig zu ersteigern und habe Potenzial als Wertanlage, schließlich steige das deutsche Nachkriegsdesign gerade im Ansehen.
Typische Verführungen zum Einstieg in die Welt der Klassiker sind aber immer noch Stühle von Eames und von Arne Jacobsen sowie Lampen aus der Bauhaus-Epoche. "Zu der Lampe kommen dann später der Stuhl, der Tisch, das Sofa...", sagt Quittenbaum, der seinen Käufern verspricht, dass sie etwas erwerben, dessen Wert eher steige als sinke. Mit jedem Möbelstück kaufe man auch ein Stück Leben; Leben, das seine Spuren hinterlassen hat in Form einer Patina, die etwa die Stahlrohre eines originalen Freischwingers von Marcel Breuer überzieht.
Neben dem großen Interesse an Auktionen wächst die Zahl der Internet-Jäger: Sammler forschen etwa bei Ebay nach seltenen Lampen von George Carwardine (etwa der Arbeitsleuchte Anglepoise), nach Tischen von Marcel Breuer, nach Fiberglasstühlen von Eames oder Aarnio. Manchmal kann das Internet eine sehr günstige Möglichkeit sein, die Wohnung zu verschönern. Nikolai Kinski etwa, Sohn des Schauspielers Klaus Kinski, hat bei Ebay für 32 Euro eine orangefarbene Artemide-Lampe von Giancarlo Mattioli ersteigert: "Sie ist mein Magic Mushroom. Ihr Licht beamt mich in andere Sphären."
Ein anderer Jägertyp ist der Modemacher Wolfgang Joop: "Ich bin Sammler von Unikaten." Stolz präsentiert er einen Paravent von Charlotte Perriand, "1990 in New York gekauft, eine kunsthistorische Einmaligkeit", wie er sagt. Der Paravent sei von Perriand im Atelier von Le Corbusier gebaut und anschließend bemalt worden von der Kubistik-Künstlerin Sonia Delaunay. Für Joop sind solche Möbel wertvoller als Skulpturen und andere Kunstwerke: "Kunst lebt an der Wand, Möbeldesign lebt am Körper." Möbel seien berührbar, Kunstwerke nicht. Joop hat eine Scheune voller Möbelkunst, die er regelmäßig entleeren muss, um Platz zu schaffen für Neuerwerbungen. Wenn er etwas bei Sotheby's in London versteigern lasse, so der Modemacher, erziele er himmelhohe Gewinne.
Adressen
Aufgemöbelt
Wer Klassiker sucht, sollte gut aufpassen - manches Stück ist nur nachgemacht
Gärtner
, Hamburg, Große Bleichen 23, Tel.: 040/3 56 00 90;
Casa-Möbel
, München, Leopoldstr. 121, Tel.: 089/3 60 48 30;
Frick
, Frankfurt, Hochstr. 29, Tel.: 069/28 51 31;
Zapp - Art Furniture
, Berlin, Hackescher Markt, Bogen 4 Süd, Tel.: 030/7 81 73 84;
Forum
, Düren, Kaiserplatz 19, Tel.: 02421/1 52 31
Den Kunden, die diese stattlichen Preise nicht zahlen wollen, bietet sich eine günstige Alternative: Möbelhäuser, die mit Restbeständen oder Macken-Möbeln handeln. Bei "Who's perfect" etwa kostet der "Barcelona"-Stuhl nur einen Bruchteil dessen, was beim Fachhändler verlangt wird. Dafür muss der Käufer das Risiko in Kauf nehmen, ein Plagiat erstanden zu haben. Händler wie "Who's perfect" machen sich nämlich eine Besonderheit des italienischen Rechts zunutze, das die Fertigung von unlizensierten Design-Möbeln erlaubt - offiziell nur für den Vertrieb in Italien selbst. Es ist kaum nachvollziehbar, ob hier wirklich Restbestände ins Ausland gelangen - oder Plagiate, also unerlaubte Kopien.
Preise
Design-Klassiker, egal ob als Original oder als lizenzierter Nachbau (etwa der Firmen Cassina und Knoll), sind keine Schnäppchen. Ein "Barcelona"-Sessel von Knoll kostet um die 4500 Euro. Für einen LC2-Sessel von Le Corbusier aus dem Haus Cassina sind mehr als 3000 Euro fällig. Ein Anbieter, der weniger verlangt, verkauft vermutlich kein Lizenz-Produkt. Auch bei Ebay-Versteigerungen, deren höchstes Gebot deutlich unter den Listenpreisen der Hersteller liegt, sollte man vorsichtig sein: Hier handelt es sich oft um Plagiate.
Tatsache ist: Keines dieser verbilligten Stücke trägt die bei Cassina, Knoll und Thonet obligatorische Seriennummer, die in den Möbelstahl eingestanzt ist. Die Preise der Nummerlosen sind vergleichsweise niedrig, doch umso höher kann der Wertverlust sein: Ein geklonter "Barcelona" lohnt das Geld auch deshalb nicht, weil Ästheten und Kenner einen "Brechreiz bekommen bei seinem Anblick", wie der Möbelhändler Frank Anger-Lindemann sagt. Und das möchte man ja niemandem zumuten.