Wenn Lizeth Castro es sich genau überlegt, ist sie Chefrepräsentantin von 600.000 Menschen, dabei ist sie erst 17 Jahre alt. Sie vertritt zehnjährige Schuhputzer und zwölfjährige Hausangestellte, jugendliche Marktmädchen und Maurergehilfen, und ein paar sechsjährige Straßenverkäufer sind auch darunter.
"Seit wann bist du Gewerkschaftsboss?" "Seit zwei Jahren, mit 15 habe ich angefangen. Aber ich nenn' mich nicht Boss." "Wie lange arbeitest du selber schon?" "Seitdem ich sechs bin. Ich war schon Fischverkäuferin und Kindermädchen und Kellnerin und Putzfrau." Sie verbessert sich: "Putzmädchen." Lizeth Castro steht vor der Hauptkathedrale in La Paz, Boliviens Regierungssitz auf 3650 Meter Höhe. Es ist ein feuchtkalter Freitagabend, von den Gipfeln der Anden schweben dichte Nebelschwaden hinunter in den Kessel der 2,3-Millionen-Stadt. Lizeth kommt gerade von ihrem Zweitjob als Straßenlotsin und wartet auf einige Kinder für eine Beratung über Kinderarbeit. Danach will sie schnell nach Hause, um sich auf eine Jura-Prüfung an der Uni vorzubereiten. Mit 17 hat sie schon den Terminplan einer Ministerin.

Die Kinder, eingepackt in dicke Pullover, haben Fragen an sie, die man so wohl nur in einem Land wie Bolivien hört: "Wie alt muss ich sein, um arbeiten zu dürfen?" "Zehn", antwortet Lizeth, "laut dem neuen Gesetz zur Kinderarbeit, Artikel 129. Aber das gilt nur für Selbstständige, also Bonbonverkäufer oder Schuhputzer oder so was." "Und als Angestellte?" "Da müsst ihr zwölf sein. Wenn ihr zum Beispiel als Küchenhilfe arbeitet oder Maurer", erklärt Lizeth. "Und meine Eltern?" "Die müssen ihre Zustimmung geben." "Darf ich in einem Bergwerk arbeiten?", fragt ein kleiner Junge, Luis, gerade mal elf. "Ich würde es dir nicht raten", antwortet Lizeth. "Bergwerk und Nachtarbeit sind illegal in eurem Alter. Aber ich verstehe eure Not, Geld verdienen zu müssen." "Und wenn ich mich nicht ans Gesetz halte?", versucht Luis es anders. "Dann bekommen deine Eltern Besuch vom Staat." "Theoretisch jedenfalls", sagt sie, uns zugewandt. "Es wird leider kaum überprüft." Die Jungen blicken sie etwas ernüchtert an. Lizeth ahnt, was sie hören wollten. Dass sie arbeiten können, ohne jede Begrenzung. Sie reicht ihnen ein Faltblatt zum neuen Gesetz. Der Titel lautet: "Für eine würdige Arbeit und bessere Welt."
Kinderarbeit in Bolivien seit drei Jahren legal
Als Vorsitzende der Gewerkschaft Unatsbo (Vereinigung der Kinderarbeiter Boliviens) wandert Lizeth Castro auf einem schmalen Grat. Kinderarbeit ist in Bolivien seit drei Jahren legal - einzigartig in der Welt, nicht jedoch hartes Schuften auf Feldern oder in Bergwerken. Die Kinder müssen mindestens zehn Jahre alt sein und gleichzeitig zur Schule gehen. Sie sagt: "Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie wichtig es ist, Geld für die Familie zu verdienen. Aber ich weiß auch, dass darunter oft die Schule leidet."
Lizeth verteilt weitere Faltblätter an die Kinder und Jugendlichen auf der Plaza Murillo vor dem Präsidentenpalast. Sie lädt sie zu den nächsten Workshops von Unatsbo ein. Es gibt in Bolivien bis zu einer Million Kinder- und Jugendarbeiter. Vor fünf Jahren haben sie sich zusammengetan, um ihre Interessen durchzusetzen. Sie wollen gerechte Gehälter und verbesserte Arbeitsbedingungen, einen Zugang zu den Sozialsystemen und ein Ende der Ausbeutung. Aber in erster Linie wollen sie: das Recht auf Arbeit.
"Ihr in Europa versteht das nicht", sagt Lizeth. "Ihr habt diese Vorstellung, dass Kinder nicht arbeiten sollen. Schön und gut, aber das ist in meinem Land unrealistisch. Familien wie meine eigene könnten ohne die Arbeit der Kinder nicht überleben. Und ganz ehrlich: Es war nicht das Schlechteste für mich. Ich habe viel gelernt." Lizeth geht nach Hause Richtung El Alto, der wuseligen Vorstadt im Hochgebirge, gelegen auf 4100 Metern. Die Kälte der Höhe durchdringt ihre Jacke und ihren Pullover. Auf dem Kopf trägt sie eine dicke Wollmütze, unter der ihre langen schwarzen Haare in zwei Strängen hervorschauen. Sie teilt sich in einem Armenviertel ein kleines Zimmer mit einer ihrer Schwestern. Ihre Mutter starb vor fünf Jahren an Krebs, ihren Vater kennt sie nicht.
Ihrer Meinung nach ist sie prädestiniert für den Job als Leiterin der Kindergewerkschaft. Sie kennt Bolivien von ganz unten. Sie kennt die Gehälter eines Putzmädchens, umgerechnet 25 Dollar pro Monat. Sie weiß aus eigener Erfahrung um die Schmiergelder, die Arbeitgeber an Polizisten zahlen, um Kinder auszubeuten. Sie kennt auch die Schreie der Mädchen, die als Sexsklavinnen in Nachbarhütten gehalten wurden. "Ich habe alles schon mal erlebt", sagt sie, als blicke sie nicht auf 17, sondern auf 70 Jahre Leben zurück.
"Ich habe vieles durchgestanden", sagt Lizeth
Lizeth Castro wuchs in einer Armensiedlung von El Alto auf, mit ihrer Mutter und fünf älteren Geschwistern. Sie lebten in einem einzigen Zimmer einer zugigen Backsteinhütte. Jeden Morgen nahm die Mutter die Kinder mit nach La Paz und ließ sie gemeinsam als Putzmädchen und Küchenhilfen arbeiten. Am Nachmittag sammelte die Mutter sie wieder ein und setzte sie an der Schule ab.
"Der Alltag war meine beste Schulung für die jetzige Aufgabe", sagt Lizeth. Die Erfahrung formte ihr Weltbild: Ich will nichts geschenkt bekommen. Ich muss arbeiten, um Schulbücher zu kaufen. Ich muss studieren, um der Armut zu entfliehen. Auf den Staat oder Unicef oder die Werte des Westens kann ich mich nicht verlassen.
Und sie lernte an der Seite ihrer Geschwister etwas Zweites: Nur gemeinsam sind wir stark. Je mehr wir sind, desto eher kann man im Kampf bestehen. Das sind die beiden Grundpfeiler ihres Lebens: Selbstbehauptung und Solidarität. In jedem Fall: stark sein. Stark allein. Stark zusammen. Lizeth sagt: "Ich bin sehr stolz auf mich. Ich habe vieles durchgestanden." Braucht es solche harten Erfahrungen, um stark zu sein? "Ich will dieses verwöhnte Leben nicht. Ich sehe es ja in den Serien im Fernsehen. Die Jugendlichen bei euch in Europa hängen in Shoppingcentern ab, sie sind auf Facebook und gehen auf Partys. Wie erfüllend ist denn ein Leben mit einer Hand am Handy und der anderen am Cappuccino?"
Am Wochenende gibt sie einen Workshop im Zentrum von La Paz, im Hinterhof einer Schule. Es geht darum, die Rechte der Kinder durchzusetzen und ihr Selbstbewusstsein zu stärken. An der Wand steht die Losung: "Kinder haben ein Recht auf Arbeit." Daneben hängen Bilder, die Kinder und Jugendliche über ihre Arbeit gezeichnet haben. Es geht in den meisten nicht ums große Glück oder um Stärke, sondern um Ausbeutung und Missbrauch.
Die Workshop-Teilnehmer sind kurz sprachlos
Die Teilnehmer des Workshops, Jugendliche im Alter von zehn bis 14 Jahren, backen und kochen erst zusammen. Dann stellen sie unter Anleitung von Lizeth und einer Psychologin Situationen aus ihrem Arbeitsleben nach. Bea, zwölf, und Anna, 13, spielen ein Erlebnis eines Mädchens, das von einer Familie in der wohlhabenden Südzone von La Paz quasi als Leibeigene gehalten wird. Zwei andere Mädchen stellen dar, wie Eltern ihre eigene Tochter an einen Sklavenring aushändigen.

Für einen Moment sind selbst die hartgesottenen Teilnehmer des Workshops sprachlos. Es geht da nicht nur um Ausbeutung, sondern um Verbrechen. Kinderarbeit mag zum Familien einkommen beitragen, aber sie ist oft genug auch eine Einladung zum Missbrauch.
Die Psychologin sagt: "Wir wollen euch die Arbeit nicht verbieten. Wir wollen aber, dass ihr die Gefahren kennt. Das neue Gesetz besagt: Die Zwangsarbeit und Ausbeutung von Kindern sind verboten."
In den folgenden Stunden arbeitet Lizeth mit den Jugendlichen an Lösungen. Sie trainieren die Optionen: den Arbeitgeber konfrontieren. Laut schreien. Die Polizei rufen. Die Staatsanwaltschaft informieren. Bea sagt in der Übung standhaft: "Nein, das dürfen Sie nicht. Sie dürfen mich nicht länger als sechs Stunden pro Tag beschäftigen. Das verbietet das Gesetz. Ich informiere die Staatsanwaltschaft." Sie beginnt zu weinen. Es tut gleichzeitig weh und gibt Hoffnung.
Dann hält Lizeth ihnen einen Vortrag. Die Kinder kennen und respektieren sie. Für viele ist sie ein Vorbild, ein Mädchen, das wie sie arbeitet und gleichzeitig eine große Organisation anführt und sogar beim Staatspräsidenten im Palast war. Sie erklärt ihnen: "Es wäre schöner, wenn wir nicht so hart arbeiten müssten, aber es ist nun mal Realität. Umso wichtiger ist es, dass wir unsere Rechte kennen und uns wehren können."
In der Aymara-Sprache gibt es 150 Begriffe für Arbeit
Im neuen Gesetz, Artikel 130, heißt es: Der Staat garantiert, dass alle Mädchen und Jungen dieselben Rechte haben wie erwachsene Arbeiter. Dann Artikel 132: Für gleichwertige Arbeit müssen Kinder das gleiche Gehalt wie Erwachsene erhalten und nicht weniger als das nationale Mindesteinkommen. "Merkt euch das. Ihr habt zudem das Recht, an Gewerkschaftssitzungen teilzunehmen und auf Zugang zu gesetzlichen Sozialleistungen. Und noch etwas", mahnt sie zum Schluss: "Wer das nicht beherzigt, macht es anderen Kindern nur schwerer." Das neue Gesetz wurde verabschiedet, nachdem Präsident Evo Morales vor drei Jahren Lizeth und ihre Mitstreiter im Nationalpalast empfangen hatte. Er erzählte aus seinem eigenen Leben als arbeitender Indianerjunge vom Volk der Aymara.
Wie er schon als Neunjähriger schuftete, auf dem Feld und als Eisverkäufer, und dadurch stark und selbstbewusst wurde. Dann wies er noch auf etwas anderes hin: In der Sprache der Aymara gibt es 150 Begriffe für Arbeit. Aber sie haben nichts mit Ausbeutung oder Missbrauch zu tun. Es geht darum, Kinder an die Aufgaben des Lebens heranzuführen, Häuser zu bauen, dem Vater auf dem Feld zu helfen, der Mutter in der Küche, Samen zu pflanzen, Heu zu bündeln. Fürs Leben zu lernen nicht für die Schule. "Das hat mich besonders beeindruckt", sagt Lizeth.

Sie sieht sich als Linke, als Anhängerin des sozialistischen Präsidenten Evo Morales. Er sei ein echtes Vorbild, ein Kämpfer für Gerechtigkeit und Indigenenrechte, auch wenn internationale Beobachter schimpfen, dass er zunehmend autoritär regiere. Sie pfeife auf Demokratie, wenn es dem Land besser gehe, sagt sie beim Gespräch in einem Café. Sie sagt, ein Moment wie dieser sei Luxus für sie. Kakao und reden.
Links zu sein heißt für sie, sich wie der Präsident für die Rechte der Rechtlosen einzusetzen, erklärt sie, für Indianer und Kinderarbeiter. Die Ungleichheit in ihrem Land und auf der Welt sei das Thema dieser Zeit, das Thema ihrer Generation. "Solidarität!", sagt sie emphatisch, als sei es ihr Wahlslogan. Solidarität heißt für sie, nicht nur auf die Straße zu gehen, um zu protestieren, sondern zu handeln, die Führung zu übernehmen. "Ich will Anwältin werden, um Kinder zu verteidigen. Wenn ich eines Tages gefragt werde: 'Was hast du mit deinem Leben gemacht?', will ich nicht sagen: Ich habe Geld verdient und zufrieden gelebt, sondern: Ich habe die Welt besser gemacht."
Links, das ist der Kampf gegen Unicef
Aber was ist mit den anderen Weltverbesserern, denen, die sich für die Abschaffung der Kinderarbeit einsetzen bei Unicef und der Internationalen Arbeitsorganisation Ilo? "Ich finde, das ist Heuchelei", entgegnet Lizeth bestimmt. "Die sitzen in Behörden und regieren die Welt aus Büros. Die haben keine Ahnung, wie wichtig Kinderarbeit fürs Überleben der Familien ist." Doch, die wissen das. Wir haben mit ihnen gesprochen. Sie sitzen hier in La Paz und kennen die Situation. Sie suchen nach Lösungen, damit Kinder eine bessere Ausbildung erhalten, um gerade nicht solche Knochenjobs machen zu müssen.
"Du verstehst das nicht. Du kommst auch von da", sagt Lizeth. "Die wollten unsere Rechte blockieren." Sie holt nun das Gesetz hervor und zitiert Artikel 126: "Wir haben das Recht auf sichere Arbeit, wenn wir unsere Ausbildung und Gesundheit nicht riskieren." Sie sagt es nicht patzig, eher belehrend und mit der Gewissheit, das Leben in Bolivien zu kennen. Wenn Unicef gegen Kinderarbeit kämpft, dann heißt links sein für sie eben, gegen Unicef zu kämpfen.

Es sei eine verwirrende Welt da draußen, in der man sich politisch nur schwer zurechtfinde, sagt sie. Die Amerikaner hätten erst den besten Mann gewählt, Barack Obama, und dann den schlimmsten, Donald Trump. Indigene in ihrem Land haben endlich mehr Macht, aber auch sie seien oft korrupt. Sie bleibt da lieber bei dem, was sie kennt, dem kleinen Kampf, mit dem sie Großes bewirken kann. Das ist ihr Rat an die Welt, wenn man das so sagen kann: Führt den Kampf im Kleinen, dort, wo ihr gut seid. Wenn sie das Leben von einem Kind verbessern kann, ist das schön. Wenn sie sogar die Leben von 600.000 Kindern leichter machen kann, umso besser.
Ein anderer Tag. Lizeth macht sich schon morgens um sechs auf den Weg zur Stadtverwaltung, für die sie als Verkehrslotsin und Animateurin arbeitet. Zum ersten Mal in ihrer Karriere ist es so etwas wie eine offizielle Beschäftigung mit Vertrag und Erlaubnis und allem.
Lizeth nennt das: Leben
Sie weiß, dass nicht alles funktioniert mit dem neuen Gesetz. Einige Arbeitgeber schrecken jetzt davor zurück, Kinder überhaupt einzustellen. Das Arbeitsangebot geht zurück. Manche Jugendliche gehen deswegen auf den Strich oder handeln mit Drogen. Zudem kommen die Behörden nicht hinterher, alle Anträge zu prüfen und Missbrauchsfälle zu untersuchen. "Als Unatsbo wollten wir Gutes, aber die Realität hält sich nicht immer daran." Lizeth zwängt sich in ein Zebrakostüm und stellt sich an eine Kreuzung. Sie hampelt lustig herum und regelt den Verkehr. Sie hilft Kindern und alten Menschen über die Straße und gibt ihnen Tipps für eine bessere Welt mit auf den Weg: "Werft den Müll nicht auf die Straße", sagt sie Kindern, die Bonbonpapier fallen lassen. "Schalte doch mal den Motor aus und verpeste nicht die Luft", sagt sie Autofahrern im Stau. Sie ist Animateurin und Aufklärerin zugleich. Eine Erzieherin der Bürger im Auftrag der Stadt. Eine Jugendliche, die Erwachsenen das richtige Verhalten erklärt.
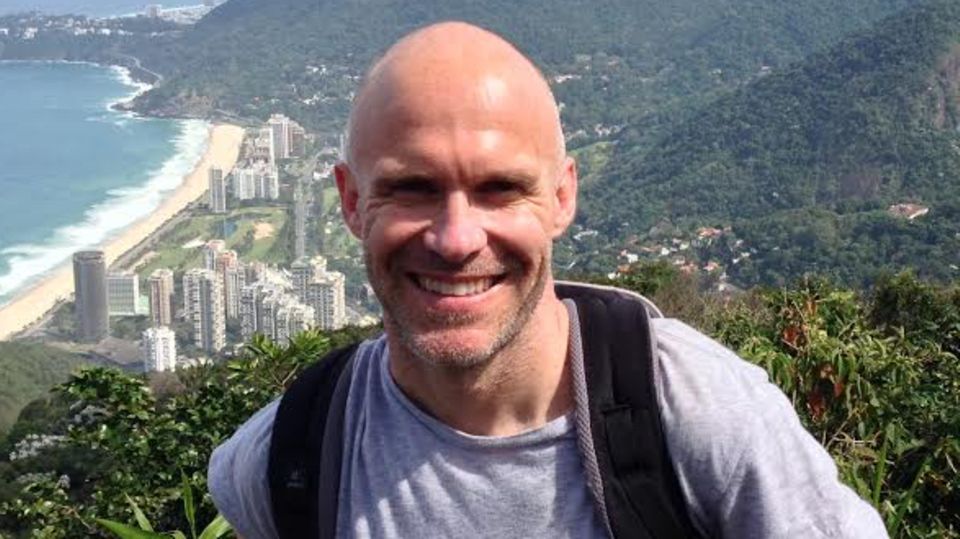
Erst um Mitternacht kehrt sie nach Hause zurück, in ihre einfache Hütte in einem Armenviertel hoch über den Wolken, und macht sich an eine Hausarbeit über Strafrecht. Eigentlich ist sie Studentin, aber fürs Studium bleiben ihr nur drei Stunden am Tag. Sie ist gleichzeitig Erzieherin und Marktfrau, Gewerkschaftsboss und Weltverbesserin, Schwester, Tante und Teil einer Solidargemeinschaft.
"Ist das nicht etwas viel?", fragen wir sie in jener Nacht. Sie versteht die Frage nicht. Sie nennt das: Leben.









