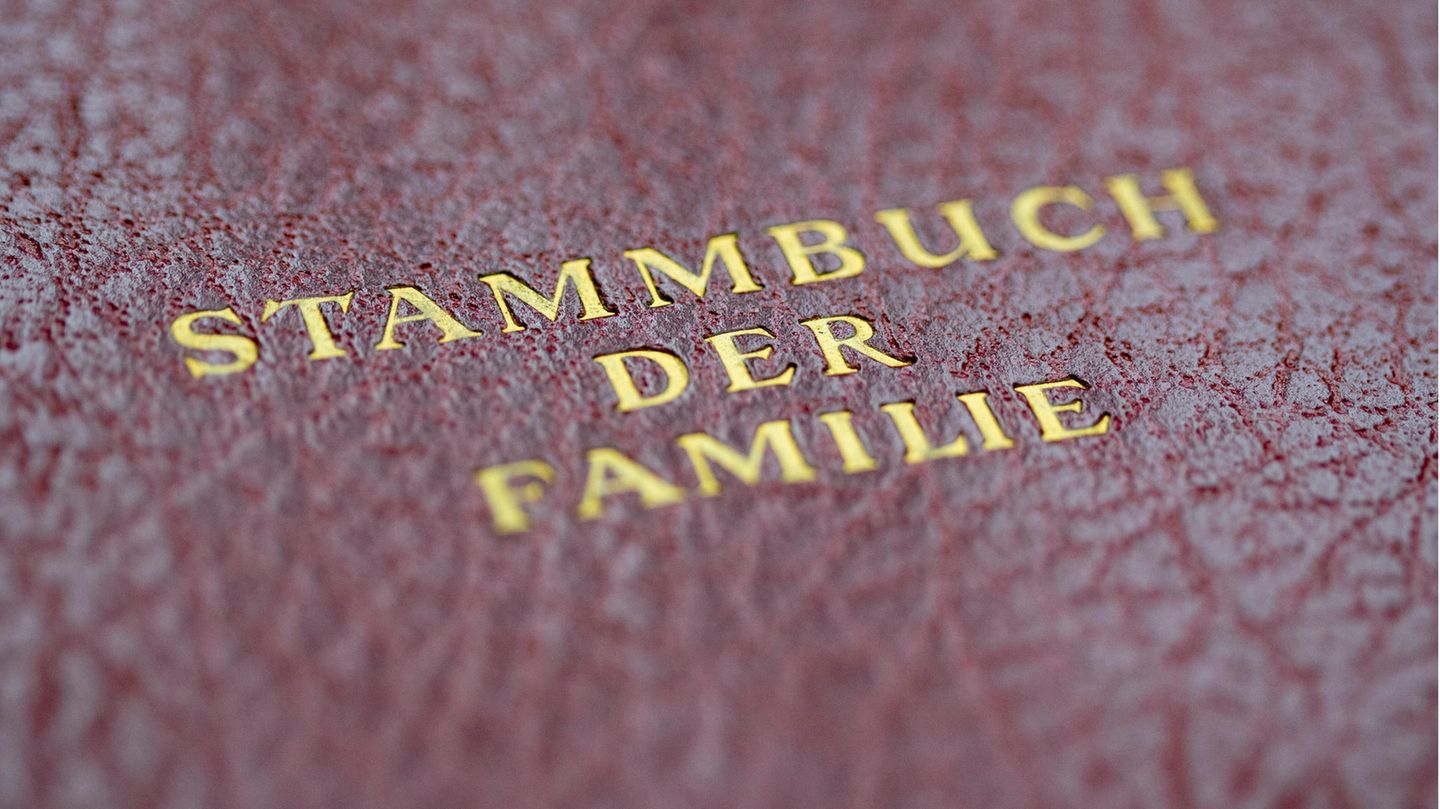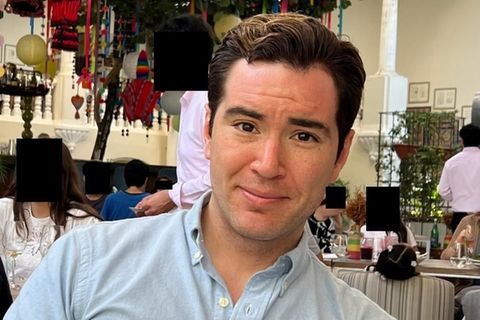"Ich fühle mich betrogen", sagt Maria Diemar. "Ich habe so viel verpasst." Die 47-Jährige lebt in Schweden, aber stammt eigentlich aus Chile. Im Alter von zwei Monaten ist sie ihrer Mutter entrissen und in einer Zwangsadoption nach Europa gebracht worden. Der Familie, die das Neugeborene damals aufnahm, erzählte man bei der Vermittlung, dass die Mutter das Kind freiwillig abgegeben hätte. In diesem Glauben wuchs die Chilenin in Europa auf. Die traurige Wahrheit sollte erst 40 Jahre später ans Licht kommen.
Zwangsadoptionen waren gängige Praxis in Chile
Maria Diemar ist eines von Tausenden Babys, die während der Militärdiktatur in Chile in den 70er- und 80er-Jahren von ihren Müttern getrennt und illegal aus dem Land geschafft worden sind. Unter der Herrschaft von Augusto Pinochet etablierten sich die Zwangsadoptionen als gängige Praxis. Für den Herrscher waren sie Teil einer nationalen Strategie, um die Armut im Land zu reduzieren. Die Kinder galten "als Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung des Landes", erläutert Professorin Karen Alfaro Monsalve von der Austral-Universität in Chile im Gespräch mit der "New York Times".
Opfer dieser Verbrechen waren vor allem junge, arme Frauen aus ländlichen Gegenden, die dem indigenen Mapuche-Volk angehören. Mitglieder der Eingeborenen-Gemeinde seien laut einem Bericht des "Guardian" wie Bürger zweiter Klasse behandelt und lange Zeit verfolgt worden. Die Ureinwohner waren in den Augen der Regierung eine "Behinderung für den Fortschritt". Laut Karen Alfaro Monsalve, die die Fälle der Zwangsadoptionen umfassend recherchiert hat, steckte noch ein weiteres Motiv dahinter. Die Vermittlung der Kinder ans Ausland galt als "Maßnahme, um diplomatische Beziehungen wieder aufzubauen". Die chilenische Regierung hätte es so aussehen lassen, als wolle sie den Kindern ein besseres Leben ermöglichen.

Die Zwangsadoptionen liefen fast immer nach dem gleichen Schema ab. Kurz nach der Geburt seien die Säuglinge für angebliche Untersuchungen von den Müttern getrennt und wenig später für tot erklärt worden. Das passierte Maria Diemar, ebenso wie Camila Schwarz. "Man hat meiner Mutter gesagt, dass ich nach der Geburt verstorben sei. Man hat sie angelogen", berichtet die Chilenin, die zu einer Familie in die Schweiz kam, dem "Deutschlandfunk". Tyler Graf, der in den USA aufgewachsen ist, war zwei Wochen alt, als das Klinkpersonal seiner damals 26-jährigen Mutter eintrichterte, ihr Neugeborenes sei verstorben. Den Eltern sei es weder erlaubt gewesen, das Kind noch einmal zu sehen, noch hätten sie eine Sterbeurkunde erhalten.
Klima der Angst während Diktatur in Chile
Die meisten Müttern ahnten zwar den Betrug, doch das allgemeine Klima der Angst während der Diktatur erstickte den Widerstand der jungen Frauen im Keim. "Das ganze öffentliche System war involviert: Krankenhäuser, Notare, Rechtsanwälte, Richter", erklärt Alejandro Quezada im "Deutschlandfunk". Mit zwei weiteren adoptierten Kindern gründete er die Organisation Chilean Adoptees Worldwide (CAW).
"Das öffentliche System, das eigentlich dazu da ist, Menschen zu schützen, klaute Kinder und schickte sie ins Ausland", fügt er hinzu. Ein ganzes Netzwerk an Beamten, Richtern, Sozialarbeitern und Adoptionsvermittlern soll beteiligt gewesen sein und gegen Bestechungsgelder die Dokumente gefälscht haben. Pro Kind hätten die Adoptionseltern laut "Guardian" 6.500 bis 150.000 Dollar gezahlt. Von den Summen seien dann alle Beteiligten bezahlt worden – ein lukratives Geschäft. Die Vermittlungsagenturen im Ausland hätten den Prozess auf chilenischer Seite nicht hinterfragt. Man habe damals im rechtlichen Rahmen agiert, ließ beispielsweise ein schwedisches Adoptionszentrum den "Guardian" wissen. Sowohl die Adoptiveltern als auch die Kinder seien überzeugt davon gewesen, dass die leiblichen Eltern ihr Baby freiwillig in fremde Obhut gegeben hätten.
Gefälschte Erklärungen der Mütter
So war es auch den Adoptionspapieren zu entnehmen. "Sie wird in einem idealen Zuhause für ihre körperliche, geistige und emotionale Entwicklung aufwachsen, das ich ihr unter meinen Umständen niemals geben könnte", war den Dokumenten von Maria Diemar zu lesen. Eine angebliche Erklärung der Mutter, die diese aber nicht selbst angefertigt hat, wie sich später herausstellte.
"Meine Adoptivmutter und mein Vater hatten mir gesagt, dass meine leibliche Mutter mich angeblich im Krankenhaus liegen gelassen hat und nach Argentinien abgehauen ist", berichtet Ruth Corinna Stein, die mit drei Jahren nach Bad Homburg gekommen ist, im Gespräch mit dem "Deutschlandfunk". In den Papieren von Tyler Graf stand, dass seine Mutter zu wenig Geld und bereits andere Kinder zu versorgen hätte. "Ich habe diese Bitterkeit mein ganzes Leben mit mir getragen", sagt er der "New York Times".
Bis zu 20.000 illegale Adoptionen in Chile
Während eine Vielzahl grausamer Verbrechen – Morde, Folter, Entführungen – während der Herrschaft Pinochets bekannt sind, wurde der Menschenhandel mit den Babys erst 2014 langsam aufgedeckt. Drei Jahre später startete das Berufungsgericht in Santiago de Chile erste Ermittlungen. In der "New York Times" bestätigt Richter Mario Carroza, dass der Justiz bereits 8000 Fälle vorliegen. Die Gesamtzahl der Zwangsadoptionen schätzt er jedoch auf bis zu 20.000.

Zusätzlich rief der Kongress eine Untersuchungskommission ins Leben. In einem ausführlichen Bericht des Ausschusses werden die Zwangsadoptionen als "Verbrechen gegen die Menschlichkeit" eingestuft. "Es ist ein riesiger Skandal, der passiert ist", zitiert "Deutschlandfunk" eine dänische Lokalpolitikerin, die fordert, das Thema ins europäische Parlament zu bringen.
Mehrheit der Kinder noch immer auf der Suche
Für die Eltern und Kinder gibt es inzwischen eine DNA-Datenbank bei der chilenischen Regierung, um den Familien zu helfen, sich gegenseitig zu finden. Etwa 500 Zusammenführungen habe es laut der "New York Times" bisher gegeben. "Als ich in Chile war, habe ich geheult vor Freude", erinnert sich Camila Schwarz an die erste Begegnung mit ihrer leiblichen Mutter. "Ich wusste gar nicht, was ich fühlen sollte", erzählt sie. Inzwischen pflegt sie einen intensiven Kontakt zu ihren südamerikanischen Verwandten. Bei Tyler Graf fiel das Wiedersehen ebenfalls emotional und liebevoll aus.
Maria Diemar konnte ihre Mutter zwar ausfindig machen, zu einem Treffen kam es bisher aber nicht. Die Mehrheit der adoptierten Chilenen ist noch immer auf der Suche nach der leiblichen Familie. Die Organisation von Alejandro Quezada unterstützt sie bestmöglich. Dabei machen sich auch die traumatischen Folgen bemerkbar, die die Zwangsadoptionen hinterlassen haben. "Wir sehen an den Personen, denen wir helfen, dass 75 bis 80 Prozent psychisch irgendwie geschädigt sind", berichtet er bei "Deutschlandfunk".
Dunkles Kapitel in der Geschichte von Chile
Obwohl sich die Regierung der Sache inzwischen angenommen hat, gibt es Kritik an der bisherigen Aufklärungsarbeit. Die Prozesse laufen zu langsam ab und trotz der immer gleichen Akteure, die in den Papieren auftauchen, habe es noch keine Festnahme gegeben. Alejandro Quezada hingegen betont, dass dies aber auch nicht im Interesse von CAW liege.
Vielmehr wolle man sicherstellen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Dem stimmt auch Maria Diemar zu. "Das waren Verbrechen", betont sie. Die illegale Adoption sollte für zukünftige Generationen in die Geschichtsbücher eingehen.
Quellen: BBC, Camara de Disputados Chile, "Deutschlandfunk", "The Guardian", "The New York Times"