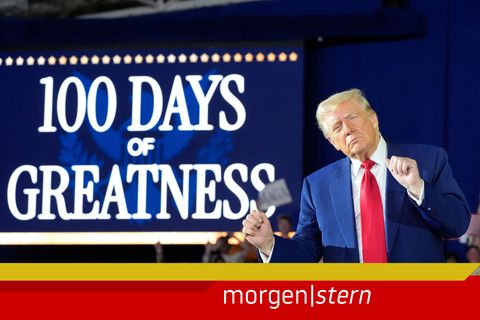Diese Reportage erschien erstmals im stern Nr.18 am 28.4.2016
Dies ist eine verdammt traurige Story aus einem kleinen fernen Land, und wer sich das nicht zumuten möchte, kann getrost weiterklicken. Die anderen werden etwas von verschwundenen Kindern erfahren und Massengräbern und dem Besuch bei einem 26-fachen Mörder.
Es geht in dieser düsteren Story um einen vermissten Jungen und vier ziemlich gezeichnete Männer, die bei der Spurensuche in El Salvadors Unterwelt aufeinandertreffen. Da wäre Pastor Johnny - ein Prediger, der tagsüber zum Polizisten wird. Und Israel Ticas - ein Forensiker, der in 50 Meter Tiefe nach Leichen gräbt. Da wäre Zeus - ein Massenmörder, der seinem Sohn abends Kinderbücher vorliest. Und schließlich Perez, ein armer Wachmann, der bisher nur zwei Finger von seinem Sohn Alex wiederfand.

Alex ist verschwunden, seit einem Jahr schon, vermutlich tot, aber nicht mal der Tod kommt in El Salvador mit letzter Gewissheit.
Die anderen vier sind - Stand Ende April - noch am Leben, und das ist, so gesteht ein jeder, eine ziemlich dicke Überraschung.
Dass mit diesem abgefuckten Land etwas nicht stimmt, merkt man schon bei der Ankunft am Flughafen, wenn der Grenzbeamte, ein Mann mit pelzigem Schnauzbart, knurrt: Was willst du als Deutscher hier? Es ist ein Land der Scheiße.
Es besuchen.
Was gibt’s hier zu besuchen?
Ich berichte für ein Magazin.
Aha, sagt der Beamte. Dann kann es sich ja nur um Gewalt drehen.
Der Beamte erzählt von seiner Familie, die vor dieser "allgegenwärtigen Gewalt" nach Nordamerika, Mexiko, Panama geflohen ist, und hat ein paar Ratschläge parat: keine blau-weißen Klamotten. Die trägt die Bande MS-13. Und keine blau-schwarzen Klamotten. Die trägt die Bande Barrio 18. Und keine Cortez-Sneaker von Nike. Das kann dein Tod sein. Ansonsten: Willkommen in El Salvador.
"Wir wurden geboren, um ohne Mitleid zu töten"
Auf dem kurvigen Highway vom Flughafen am Pazifik in die Berge der Hauptstadt San Salvador wirkt das Land nicht anders als so viele in Lateinamerika, Regenwälder, Bananenstauden, Kokospalmen, jene dschungelgrüne Üppigkeit, die es in jeden Reisekatalog schaffen könnte. Aber dann zeigen sich auf den Ladeflächen der Pickups die ersten maskierten Soldaten mit MGs. Über Hauswände erstrecken sich die einschüchternden Botschaften der Maras, der Gangs: "Wir wurden geboren, um ohne Mitleid zu töten." Und spätestens wenn der Taxifahrer sagt: "In dem Staub der Straße wird auch Knochenmehl von Menschen sein", ist man angekommen in der Realität von El Salvador: 6 Millionen Einwohner, 2000 Vermisste pro Jahr, 6500 Morde - die höchste Mordrate der Welt.
Man kann das Elend an solchen Zahlen festmachen. Oder an einer einzigen Frage: Was geschah mit Alex?
Die Suche beginnt wie so viele in einer Colonia, einem von Straßengangs regierten Armenviertel, in diesem Fall San Bartolo, im Norden der Hauptstadt, 2000 Einwohner, eine Ansammlung kastenartiger Hütten, die sich planlos den bewaldeten Hügel hinauffressen. Als Fremder kommt man nur mit Begleitung rein oder versteckt auf dem Autorücksitz eines Pastors. In den Gassen hocken rauchende Gangster mit Schnellfeuerwaffen im Schoß. An den Zufahrten schieben zehnjährige Kinder Wache, bezahlt von der hier regierenden Gang Barrio 18. Zehn Euro bekommen sie am Tag, ein lukrativerer Job als der ihrer Eltern, die auf Kaffeeplantagen schuften.
"Der Einstieg in ihre Traumkarriere", sagt der Pastor, und man merkt, wie schnell man in diesem Land zum Zyniker wird. Alex, 15, verschwand an einem Mittwoch, dem ersten im März. Am Morgen noch sagte er seiner Mutter, dass er nach der Schule ihr Handy zur Reparatur bringen würde. So wartete die Mutter am Bus. Um 6 Uhr. Noch um 7. Bis nach 9. Dann hatte sie eine Ahnung. Verschwinden in El Salvador bedeutet eines von drei Dingen: Alex floh vor der Gewalt in die USA. Er wurde Mitglied einer Gang und damit Teil der Gewalt. Oder ein Opfer der Gewalt.
Das Wohnzimmer der Familie Perez besteht aus nicht viel mehr als einem Tisch, einem Sofa und einem Schrein, auf dem sie ihren verlorenen Sohn verewigt haben: Alex Elmer, 1,70 Meter groß, schwarze Haare, ein hübscher Junge mit dichten Augenbrauen und einem letzten Schub von Pubertätspickeln. Ein guter Schüler sei er gewesen, ein talentierter Zeichner, in erster Linie aber ein ganz normaler Junge.
Das ist das Kennzeichen vieler Opfer: ganz normale Jugendliche. In El Salvador sagt man: "Es ist ein Delikt, Kind zu sein."
"Ich kann meiner Frau die Wahrheit nicht verraten. Sie ist zu grausam."
Die Perez sitzen da wie festgefroren, Ausstellungsstücke in einem Stillleben - Vater, Mutter und Schwester, ihre Brillen beschlagen von feuchter Trauer. Sie taten alles, um Alex in diesen Zeiten des Terrors zu schützen: Er spielte kein Fußball, um nicht in die Fänge der Banden zu geraten. Er liebte kein Mädchen, weil selbst ein falscher Blick den Tod bedeuten kann. Es hielt sich an die Überlebensformel für El Salvador: Er tauschte seine Jugend gegen Sicherheit.
"Wir haben einen einzigen Fehler gemacht", sagt die Mutter, Rosa Esperanza. "Wir wollten ein besseres Leben. Deswegen sind wir nach San Bartolo gezogen." Auf der Suche nach einem Eigenheim fand die Familie hier ein billiges Häuschen. Seit dem Umzug aber musste Alex den Schulweg ins alte Gymnasium nach San Isidro machen. Er fuhr damit vom Territorium der Gang Barrio 18 in das der Gang MS-13. Der Grenzübertritt reicht als Motiv für einen Mord. Was überall normal sein mag, ist hier das Todesurteil.
An jenem Märztag wurde Alex nach dem Unterricht in eine Falle gelockt, wohl von einem alten Freund, "dann verliert sich die Spur", sagt die Mutter und zieht sich mit einem Weinkrampf in die Küche zurück. "Die Spur verschwindet nicht", flüstert der Vater, "aber ich kann meiner Frau die Wahrheit nicht verraten. Sie ist zu grausam."
Wir treffen ihn am nächsten Tag in einem Einkaufszentrum: die einzig sicheren Orte El Salvadors, so was wie demilitarisierte Zonen im Kriegsgebiet. Elmer Perez, 45, ist Wachmann, ein Haupterwerbszweig in diesem Land, das sonst nur für Kaffee und Vulkane bekannt ist und als Migrationsproblem der USA. Er sieht fertig aus, dunkle Ränder unter den Augen, eine leblose Stimme, der die Apathie jede Melodie genommen hat. "Die Polizei verweigert die Suche", erzählt er, "sie sagt, sie habe keine Zeit." Eine geläufige Ausrede für Beamte, die bei Ermittlungen gegen Maras um ihr eigenes Leben fürchten müssen.
Also hat Perez begonnen, auf eigene Faust zu ermitteln. Seine Suche führte zu einem Schulfreund, der Alex in den Unterschlupf der Gang, "Destroyer" genannt, gelockt hatte. Dort verhörten ihn Mitglieder der Bande, die "Homeboys". Die Maras haben längst ihren eigenen Sprachcode: "Fuck-up" ist die Polizei. "Ventilator" der Verräter. "Das Licht" ist der Befehl zum Töten. Und "Tanzen" das Töten selbst.
"Da wurde wohl das Todesurteil gesprochen", sagt Perez in seiner faktisch-monotonen Art. "Der Freund hat es exekutiert. Als Aufnahmeritus." Freunde töten Freunde, um in die Gang aufgenommen zu werden?
"Man muss die Maras alle töten. Es gibt keine andere Lösung."
"So ist das", sagt Perez. "Freunde töten Freunde. Männer ihre Frauen. Kollegen ihre Rivalen." Die Straflosigkeit hat ein Vakuum geschaffen, in dem alles beglichen wird: Eifersucht, offene Rechnungen, ein schiefer Blick.
"Ich fand Alex’ Turnschuh im Wald" , sagt Perez schließlich. Das Gespräch bekommt nun einen eigenen, unerträglichen Rhythmus. "Und seinen Gürtel, er war durchgeschnitten." Er holt Luft. "Und einen Finger." Er stockt. "Einen weiteren Finger." Dann hält er inne.
Das ist das Schlimmste. Perez weiß nicht, ob die abgetrennten Finger Hinweise für eine Lösegeldforderung sein sollen - oder eine makabre Schnitzeljagd, die zur Leiche führt. Die Ungewissheit macht ihn wahnsinnig.
Er umklammert den Kaffeebecher, ein plötzliches Schluchzen durchzuckt seinen Körper wie ein elektrischer Schlag. In diesem Moment steht die Agonie aller Eltern von El Salvador im Raum: Der vermisste Sohn wurde nicht einfach erschossen. Er wurde gefoltert und zerstückelt, er könnte in Einzelteilen im Wald liegen.
"Ich suche bis zum Ende weiter", sagt Perez, "ich werde ihn rächen." In Abwesenheit der Justiz sieht er sich als Richter und Henker zugleich, auch wenn er dabei sein Leben riskiert. "Ich werde von der Gang bedroht, egal, ich ziehe das durch." In diesem Augenblick wird klar, dass nur ein Tod die Erlösung bringen wird. Der des Mörders. Der von Alex. Oder sein eigener.
Schließlich sagt er den furchtbaren Satz: "Man muss die Maras alle töten. Es gibt keine andere Lösung."
Das sind 60.000 Menschen.
"Sie sind Barbaren. Killermaschinen. Nicht heilbar. Sonst kommen wir als Land nicht zur Ruhe."
Wir hören diese Sätze nicht nur von ihm. Wir hören sie auch in Kneipen, im Radio, lesen sie auf Facebook oder Twitter. Sieht man es demokratisch, führen sie zu einer unerträglichen Wahrheit: Die Mehrheit ist für einen Genozid.
Ursprünglich stammen die Gangs Barrio 18 und Mara Salvatrucha (MS-13) aus Los Angeles, gebildet von salvadorianischen Immigranten, die dem Bürgerkrieg entflohen waren. Nach der Deportation ihrer Mitglieder in den Neunzigern führten sie ihre Kriege in der Heimat fort. Nichts anderes ist das, was El Salvador erlebt: ein blutiger Krieg, auch wenn er in keine Definition der Vereinten Nationen passt.
"Töten, Vergewaltigen, Kontrollieren"
Seit einem Jahr klassifiziert der Staat Maras als Terrororganisationen. Die MS-13 hat 40.000 Mitglieder und die Losung "Kill, Rape, Control" - Barrio 18 etwa 20.000. Die wesentliche Gemeinsamkeit: Sie terrorisieren die Bevölkerung. Sie kassieren Schutzgelder - die "renta" - und entführen Bürger für 5000 Dollar. Sie töten sich gegenseitig auf bestialische Weise. Sie töten alle, die in den Verdacht geraten, dem Feind zu helfen. Sie töten, um zu töten.
Ihr Krieg erinnert eher an archaische Stammeskonflikte. So ist die Frage dieser Story nicht nur: Was geschah mit Alex? Sondern: Ist dieses Land überhaupt zu retten?
An einem Samstagnachmittag kommt der Seelsorger der Familie Perez vorbei, Pastor Johnny Flores, ein dünner Mann mit Bibel und altmodischem Hemd wie aus NVA-Zeiten. Er sagt die üblichen Dinge aus dem Repertoire der Selfmade-Evangelicals - Jesus rettet, das Schicksal liegt in Gottes Hand -, aber dann spricht er einen markanten Satz: "Ich kläre die Tat auf. Ich werde Alex und seine Mörder finden."
Pastor Flores steigt in seinen knatternden Wagen und fährt aus der Colonia heraus. Er will einen Informanten aufspüren, einen Massenmörder im Territorium der MS-13. Er legt sein Pastorenhemd ab und tauscht es gegen eine schwarze Uniform. Schließt die Bibel ins Handschuhfach und steckt eine Pistole in den Hosenbund. Abends und sonntags ist er Pastor Flores und für den Rest der Woche Ermittler Johnny, eine Kombination, die man nur in schlechten ZDF-Filmen erwartet.
Der Pastor sei so etwas wie ein Cover, erklärt er, "Pastoren sind die Einzigen, die von den Maras in Ruhe gelassen werden. Wenn sie wüssten, dass ich nebenbei Polizist bin, hätten die mich längst beseitigt." Eigentlich ist Johnny auch Ehemann, aber seine Frau stammt aus einem von der MS-13 kontrollierten Stadtteil. So lebt er, der aus einem Viertel von Barrio 18 stammt, dort. Seine Frau im Territorium von MS-13. Treffen können sie sich nur heimlich. Eigentlich ist Johnny auch Großvater, aber der Eintritt in die Colonia seiner Enkel ist zu gefährlich. Die Epidemie der Gewalt hat das ganze Leben erfasst: Ehe. Familie. Freundschaften. Die dramatische Lage El Salvadors offenbart sich weniger in Zahlen. Sie offenbart sich in dem Leben, das es nicht mehr gibt.
Eine Dienstfahrt mit Polizist Johnny, 53, ist eine Reise in die Abgründe der Menschheit. Mit einem verhärmten Gesicht, aus dem sich nur selten ein Lächeln löst, rast er durch sein Revier Apopa, eines der gefährlichsten im Land. Die Stadt hat weniger Einwohner als Paderborn, aber mehr Morde als ganz Deutschland: 300 pro Jahr. "An dieser Stelle fanden wir die abgetrennten Köpfe zweier Schulmädchen, die sich mit Maras eingelassen hatten", erzählt Johnny. "Hier erlegten wir drei Banditen. Und auf jenem Feldweg dort wurde eine junge Mutter mit ihrem Baby zerstückelt. Sie hatte sich in einen Jungen der anderen Fraktion verliebt."
Interview mit einem Massenmörder
Johnny hat eine Menge Menschen getötet, zunächst als Soldat in mehr als zehn Jahren Krieg gegen die Guerilla und dann als Polizist in zehn Jahren Krieg gegen die Maras. Wie so viele Ermittler hat er Morddrohungen erhalten und ist in die USA geflüchtet, wurde aber verhaftet und deportiert. Keine ungewöhnliche Biografie in El Salvador. So ist jeder seine eigene Gewaltspirale.
Johnny sieht es so: Er tötet als Polizist im Namen der Sicherheit. Und verzeiht sich als Pastor im Namen Gottes. Ziemlich guter Deal. Vielleicht der einzig mögliche.
Im grellen Mittagslicht der Tropen hält er vor einem klotzigen Wal Mart. Ein bulliger Mann steigt ins Auto, 1,85 Meter groß, die Haare gegelt, eine liebliche Stimme, die man eher in einem Callcenter erwartet.
Wie geht’s der Familie?, fragt Johnny.
Bestens. Mein Kleiner ist zweitbester Schüler im Jahrgang geworden.
Für einen Moment wirkt es, als wären sie Vater und Sohn. Dabei sind sie Polizist und Gangster. Staatsdiener und Staatsfeind.
Die Männer begegneten sich vor drei Jahren auf dem Schlachtfeld von Apopa. Johnny nahm Zeus damals fest, es war sein größter Fang. Zeus war ein Gangleader der Barrio 18, verantwortlich für 150 Morde, für Vergewaltigungen, Hinrichtungen, Enthauptungen, das ganze Spektrum posthumaner Verarbeitungen.
Johnny schildert ihm den Fall Alex Perez. Fragt, ob der Junge wohl noch am Leben ist - null Chance, sagt Zeus. Und wo die Leiche verscharrt sein könnte - im Dschungel, sagt Zeus. Tief in der Erde. Oder einem Schacht. Da liegen noch Dutzende.
Sie fachsimpeln eine Weile über den Fall wie zwei Männer vom Metier. Dann, angekommen auf der Wache, einer Baracke mit dem Charme eines Flüchtlingslagers, sagt Johnny: Ich überlasse Zeus nun Ihnen.
Wir setzen uns auf Plastikstühle im Schatten eines dicht belaubten Mangobaums. Um nicht erkannt zu werden, zieht Zeus eine schwarze Maske über. Seit fünf Monaten lebt er in Freiheit. Wegen seiner Kooperation mit der Justiz hat er nur drei Jahre bekommen, von denen er neun Monate absaß und den Rest in Reintegrationskursen verbrachte. Jetzt wohnt er unter einem anderen Namen im Gebiet der rivalisierenden Gang MS-13, wo ihn keiner kennt.
Als Reporter beginnt man solche Gespräche gern mit aufwärmenden Fragen, Banalitäten über Wetter und Kinder, aber das erscheint daneben, also geht es mittenrein: Sie sind ein Massenmörder. Wie viele Morde haben Sie begangen
26.
Und sind dennoch auf freiem Fuß.
Weil ich ausgepackt habe.
Es muss viele Gangmitglieder geben, die Sie jetzt töten wollen.
Stimmt. Hunderte.
Und Sie sitzen hier so ruhig in der Abendsonne unter diesem Mangobaum.
Ich versuche jetzt Morde aufzuklären und mein Land zu heilen.
"Ich töte also noch 25mal. Wird tatsächlich leichter"
Zeus schildert ausführlich seinen ersten Mord, der sehr an den Fall Alex Perez erinnert. "Um in die Gang aufgenommen zu werden, musst du töten. Ich suche mir einen Mitschüler aus. 14 Jahre, wie ich. Hielt ihn für einen Anhänger der MS-13. Konnte ihn nie leiden. Er bekam immer die schönsten Mädchen. Es ist abends gegen neun. Ich lauere ihm auf. Warte, bis er sich von seiner Freundin mit Kuss verabschiedet. Dann nähere ich mich von hinten. Er dreht sich um. Blickt mich an, voll Todesangst. Weiß, dass er sterben wird. Da drücke ich ab. Fünfmal.
Ohne Schuldgefühle?
Erst später im Bett. Da hatte ich irre Panik. Was soll ich machen, fragte ich einen Kameraden. Töte noch mal, sagte der, dann wird’s leichter. Ich töte also noch mal. 25mal. Wird tatsächlich leichter.
Zeus erzählt in detaillierter Offenheit, weder wie ein Angeber noch mit Anteilnahme, eher wie ein nüchterner Chronist des Genozids. Als sein Chef verhaftet wurde, stieg er mit 20 zum Gangleader auf - "ich galt als der Kaltblütigste". Er war fortan für alles zuständig, Strategien und Etats, er bezahlte seine Leute, deren Kleidung, Hausreparaturen, Alimente. Mit 20 war er nicht nur der Pate von Apopa, sondern auch Hauptarbeitgeber und Machthaber, die Latino-Ausgabe eines Warlords. Er agierte nach der einfachen Formel: Wer am meisten tötet, bekommt am meisten Respekt.
Wie viele Menschen hat Ihre Gang unter Ihrer Führung ermordet?
Etwa 150. Ich habe dem Richter jeden Mord geschildert. Irgendwann haben wir unsere Opfer zerhackt und enthauptet, auch bei lebendigem Leib. Eine Art Wettbewerb unter uns Banden: Wer mordet am grausamsten.
Haben Sie sich jetzt bei Angehörigen entschuldigt?
Nein, die würden mich töten.
Ziemlich feige von Ihnen, oder?
Mag sein. Aber ich will leben. Will meinem Sohn ein guter Vater sein.
Anderen haben Sie Söhne genommen.
Da senkt er zum ersten Mal den Kopf. Wir verbringen zwei Tage zusammen, schwierige Gespräche über Mordmethoden und Innenleben einer Terrorgang, und wer das ganze Interview lesen will, kann sich gern melden (info@stern.de, Betreff "El Salvador").
Irgendwann kommt Detektiv Johnny hinzu, mit seinem ewig ausdruckslosen Blick, in den einfach keine Regung will. Die beiden werden sich schnell einig: Zur Aufklärung des Falls brauchen sie Alex’ Leiche. "Ich kenne da einen verrückten Forensiker" , sagt Johnny. "Sie nennen ihn den Anwalt der Toten. Der sucht auch 50 Meter unter der Erde noch nach Massengräbern."
So ist das mit der Verbrechensbekämpfung in El Salvador. Sie läuft nicht über Sicherheitsbehörden, sondern über Vitamin B. Es ist eine Art Outsourcing der Justiz ins Private.
"Wer den IS für Barbaren hält, muss hier einen neuen Begriff erfinden"
Die Fahrt zum Forensiker führt über hügeliges Land in den Dschungel, in eine tiefgrüne Kulisse wie in alten Vietnamfilmen. Jede Orchidee, jeder Kolibri gibt plötzlich Hoffnung, Zeichen von Leben inmitten der Apokalypse, 60 Kilometer Friedens illusion, bis am Rand eines Kaffeefelds ein gelbes Plastikband einen Tatort abschirmt. Er wird bewacht von drei Polizisten mit Sturmgewehren. Dahinter kniet Israel Ticas im weißen Schutzanzug, in der Hand eine Schaufel, im Bund eine Pistole. Er legt gerade ein Massengrab frei.
Johnny und Ticas kennen sich aus Zeiten des Bürgerkriegs (1980–1992). Sie waren brothers in arms im Kampf gegen die Guerilla. Heute stehen beide im Kampf gegen die Maras. Der eine sucht die Täter, der andere die Leichen. Der eine glaubt an Rehabilitierung und Menschen wie Zeus, der andere hält sie für verloren und befürchtet für El Salvador einen Untergang wie in Syrien. "Schau dir die Barbarei nur an", sagt Ticas.
Er zeigt auf Knöchelchen in der Erde, die Reste eines kleinen Kindes. Drei Leichen hat er aus dem 15 Meter tiefen Schacht bereits freigelegt. "Vermutlich wurde zunächst das Kind hineingeworfen", rekonstruiert er, "im Angesicht der Eltern. Eine beliebte Methode, um sie zu terrorisieren. Dann wurde die Frau wohl vor den Augen ihres Mannes vergewaltigt und reingestoßen. Schließlich der Mann. Wer den IS für Barbaren hält, muss hier einen neuen Begriff erfinden."
Wie im Fall von Alex handelte es sich um eine unschuldige Familie. Sie lebte in einem von der Barrio 18 kontrollierten Dorf, die Eltern arbeiteten aber als Marktverkäufer im Territorium der MS-13.
Alex’ Leiche findet Ticas nicht. Aber er will weitersuchen. Es sollen hier noch fünf weitere Opfer liegen. Manchen Schädel stellt er später im Büro der Staatsanwaltschaft aus, seiner "Nekro-Galerie", eine Art Showroom des Landes. Er führt uns durch seine Sammlung, die Bilder sind nichts für Leute, die noch in Ruhe schlafen wollen.
"Irgendwann wird ein Kollege mich ausbuddeln müssen"
Ticas sagt: "Der Tod ist mein Vertrauter geworden. 806 Leichen habe ich nun ausgebuddelt und komme doch nicht hinterher. Die Mörder sind schneller als ich." Auch er selbst wird mit dem Tod bedroht. Irgendwann, da ist er sich sicher, "wird ein Kollege mich ausbuddeln müssen".
Nach zwei Wochen El Salvador merkt man, wie Verrohung wirkt, wie ein außer Kontrolle geratener Bandenkrieg zur Deformierung einer ganzen Gesellschaft führt. Wir finden Alex nicht, aber auf dem Weg zu ihm die Seele des Landes und seiner gebrochenen Menschen. Es siegt die furchtbare Erkenntnis, dass Morde zur Normalität werden, der Anblick entstellter Leichen, die Todessumme als abendliche Leitzahl wie im Wetterbericht, als Maßeinheit für den Tageszustand des Landes. Vielleicht meint der salvadorianische Schriftsteller Jorge Galán das, wenn er schreibt: "Wir riechen nicht mal mehr das Blut am Ende des Tages. Wir haben einen Teil unserer Menschlichkeit verloren."
Am letzten Tag begleiten wir die Gerichtsmediziner der Hauptstadt. Sie werden in der Frequenz eines Pizza-Service an die Tatorte gerufen und sammeln die Leichen in großen Müllsäcken ein wie eine Sperrmüllbrigade. Wir sehen erstochene Opfer und aufgeknüpfte Opfer und im Zwielicht des tropischen Abends eine weitere Leiche, eine junge Frau im Hausflur, erschossen in Brüste und Vagina. Das Blut tropft frisch, die Kopfhörer stecken noch im Ohr. Über ihren Rücken zieht sich ein Tattoo: GRACIELA. Der Name ihrer kleinen Tochter.
Ich stand lange vor ihr und hörte von Nachbarn ihre Geschichte. Eine arme Köchin vom Land, eine aufopferungsvolle Mutter, die nach Liebe suchte, bis ein Mann entschied, dass sie keinen anderen als ihn bekommt. Sie hätte einen eigenen Bericht verdient, zum Wachrütteln, vielleicht in einer Frauenzeitschrift, aber wie soll sie je mit Kim Kardashian und den zehn besten Schminktipps fürs Frühjahr konkurrieren.
Die Gerichtsmediziner luden sie in einen weißen Plastiksack. Das Blut lief aus dem Sack wie dicke schwarze Tinte und hinterließ kreisende Muster auf dem Beton, die der einsetzende Abendregen wieder fortspülen würde.
Dann wurde es Nacht in El Salvador.