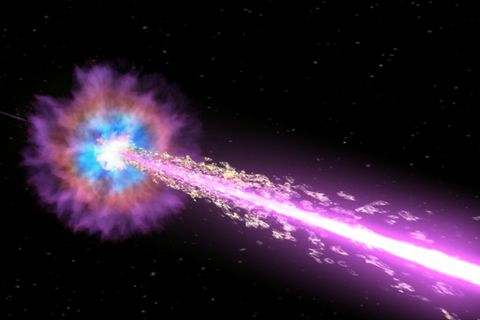Eine unveröffentlichte Studie der ESA sieht die Zukunft der EU im Weltraum: Die Europäer sollen den Mond besiedeln
Die Amerikaner sind nicht die einzigen, die es ins Weltall zieht. Die Europäer könnten und sollten bis 2025 in eigener Regie eine "permanente, bemannte Basis auf dem Mond" schaffen - eine Kolonie nicht unter dem US-Sternenbanner, sondern unter der Flagge der Europäer. So lautet das Fazit einer bisher unveröffentlichten Studie für die europäische Raumfahrtagentur ESA unter dem Titel "Der Mond: der achte Kontinent".
Mondbasis nicht unter dem Sternenbanner
Die Studie der sogenannten "Human Spaceflight Vision Group" (HSVG) wurde schon im Dezember von Ökonomen und Ingenieuren aus acht europäischen Ländern unterzeichnet. Mit dabei waren neben Franzosen, Briten und Italienern auch Fachleute vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) in Berlin sowie von DaimlerChrysler und der Daimler-Tochter EADS in Bremen.
Die Europäer sollten die Kolonisierung des Mondes in drei Etappen angehen, schlagen sie vor. Von 2012 an könnten eine Reihe unbemannter Robotmissionen den Himmelskörper erforschen. 2018 oder 2019 könnten die ersten europäischen Astronauten auf dem Erdtrabanten landen. Sie sollten dort Schritt für Schritt die Infrastruktur für eine permanente Mondbasis aufbauen, die ab 2025 in Betrieb gehen könnte. Ziel: die bessere Erforschung des Mondes sowie die Erprobung von Technologien, die es Menschen erlauben, in einer derart feindlicher Umgebung zu überleben und die nötigen Rohstoffe dafür vor Ort zu gewinnen. Der Mond werde so zum "idealen Sprungbrett" für Missionen zu Planeten wie dem Mars.
"Nicht mehr einfach immer auf den fahrenden Zug der Amerikaner aufspringen"
Die Studie weicht deutlich von bisherigen ESA-Denkspielen ab. Nach einem bereits von der ESA offiziell verfolgten Szenario unter dem Titel "Aurora" würden europäische Astronauten erst 2024 zum Mond fliegen. Hauptziel von Aurora ist die Beteiligung an einer internationalen Mars-Mission. Die Autoren der neuen Studie setzen auf das weniger ehrgeizige Ziel auf dem Mond und auf mehr europäische Eigenständigkeit. "Wir sollten nicht mehr einfach immer auf den fahrenden Zug der Amerikaner draufspringen", sagt ein ESA-Fachmann.
Den Auftrag für die Expertengruppe hatte der für die bemannte Raumfahrt zuständigen ESA-Direktor Jörg Feustel-Büechl formuliert. In seinen Augen ist das Ergebnis (wiewohl noch nicht offiziell von der ESA abgesegnet) ein "sehr praktikables Szenario". Der aus Bayern stammende Ingenieur, früher Manager bei MAN, ist überzeugt, dass die Europäer sowohl ökonomisch wie technisch in der Lage wären, eine Mondstation aufzubauen und zu unterhalten.
Kosten für Mondstation: bis zu 100 Milliarden Euro
Die Ergebnisse der Studie deckten sich durchaus zu großen Teilen mit den Vorschlägen von US-Präsident George Bush, sagt Feustel-Büechl. Wie der US-Präsident setzten die Autoren auf den Mond als erste Etappe vor einem bemannten Flug zum Mars.
Die Studie macht allerdings keine Angaben über die Kosten einer permanenten Mondbasis. Experten schätzen sie auf bis zu 100 Milliarden Euro. Heute beträgt das Jahresbudget der ESA gerade mal knapp drei Milliarden Euro, ein Fünftel der Summe, über die die Nasa verfügt.
Die ESA will der HSVG-Untersuchung nun eine Machbarkeitsstudie folgen lassen. Sie müßte auch detailliert Auskunft geben, wie die Mond-Pläne technisch realisiert werden könnten. Die Teilnehmer der Studiengruppe schlagen eine enge Kooperation mit Russland vor. So könnten die Europäer für Flüge von der Erdoberfläche in die Umlaufbahn die erprobten Sojus-Kapseln nutzen. Die "europäische Überlegenheit" könnte gerade darin bestehen, günstige russische Technik einzukaufen, sagt ein ESA-Mann.
Mond auch ökonomisch nutzen
Eine Mondbasis könnte in einer ferneren Zukunft auch ökonomischen Nutzen abwerfen, versichern die Raumfahrtlobbyisten. Eine der "verlockendsten Möglichkeiten" sei die Ausbeutung der auf dem Mond erwarteten Vorräte des auf der Erde seltenen Edelgases Helium-3. Sie könnten für künftige nukleare Fusionsreaktoren genutzt werden. "Einige Kilo davon reichen aus, um Hamburg ein Jahr mit Strom zu versorgen", glaubt Feustel-Büechl. Allerdings sei noch "unklar", wie diese Ressourcen ausgebeutet werden könnten, räumen die Autoren der Studie ein.
Wissenschaftler könnten von einem Radioteleskop auf der erdabgewandten Seite des Mondes profitieren. Es wäre in der Lage, ungestört ins All hineinzulauschen, ohne der Kakophonie des irdischen Funkverkehrs ausgesetzt zu sein.
Glaubt man den Weltallenthusiasten, dann brächte ein großangelegtes europäische Raumfahrtprojekt außerdem einen Schub für Innovation und Wirtschaftswachstum. "Wir reden über Innovation und die Amerikaner tun es", klagt Feustel-Büechl. Statt "nur die europäischen Farmer" mit jährlich über 40 Milliarden Euro zu subventionieren, stünde es der EU gut an, sich stärker in der Raumfahrt zu engagieren. Erhoffter Nebeneffekt, so der ESA-Direktor: die "europäische Identität" würde gestärkt.
Hans-Martin Tillack