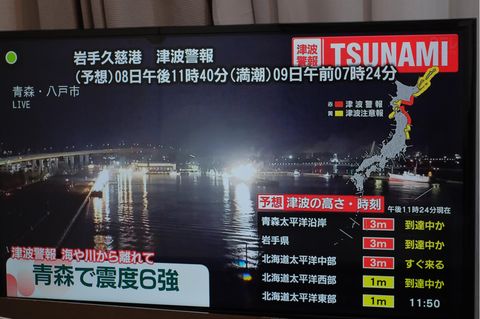Mitte vergangener Woche war es wieder so weit: Vor Sumatra brach die Erde 34 Kilometer unter dem Meeresspiegel. Rund um den Indischen Ozean wurden Tsunamiwarnungen herausgegeben, die Menschen flohen von den Küsten. Und wie immer hatte es keine messbaren Vorzeichen für das Beben gegeben. Denn während Wissenschaftler mit Weltraumteleskopen bis in die Tiefen des Alls blicken, ist das Innere der Erde noch immer voller Rätsel. Gerade mal 2111 Meter weit hat der Mensch bisher in den Boden unter dem Meer gebohrt. Und so weiß niemand, was genau sich bei einem Beben in der Erdkruste abspielt und ob es sich womöglich doch prognostizieren ließe. Wie es im noch tiefer liegenden zähflüssigen Erdmantel aussieht, konnte bislang gar nicht erkundet werden. Auf seine Zusammensetzung müssen Forscher aus Gebirgsauffaltungen und Vulkanausbrüchen schließen.
Das alles soll sich jetzt ändern. Am 21. September bricht ein japanisches Forschungsschiff der Superlative auf, die Unterwelt des Planeten zu erkunden. 600 Millionen Euro hat die "Chikyu" (japanisch für "Erde") gekostet, die im Rahmen des internationalen Tiefseebohrprogramms IODP ("Integrated Ocean Drilling Program") zum Einsatz kommt. Der 210 Meter lange Koloss mit seinem 121 Meter hohen Bohrturm verfügt über modernste Labortechnik - und einen riesigen Bohrer, der durch ein Loch im Schiffsrumpf ins Wasser gelassen wird. Er kann sieben Kilometer weit in den Meeresboden dringen - bis hinab in den Erdmantel. Auch wenn der erste Einsatz der "Chikyu" vor Japan nur die Erdkruste im Visier hat, ist er ein Wissenschaftsabenteuer: Kein Ort scheint besser geeignet, die irdische Urkraft zu ergründen, als der Meeresboden vor Japan - neben dem Sundagraben bei Indonesien eine der gefährlichsten Nahtzonen der Welt. Dort schieben sich zwei kilometerdicke Gesteinsplatten übereinander: Mit vier Zentimetern pro Jahr ruckelt der Meeresboden des Pazifiks unter die Eurasische Erdplatte. Die beiden Felsschollen sind ineinander verhakt. Löst sich die Spannung, bricht das Gestein. Dabei kann so viel Energie frei werden wie beim Einschlag eines 800 Meter großen Meteoriten.
Ein kalkulierbares Risiko
In den japanischen Metropolen weiß jeder, dass der nächste große Schlag irgendwann kommen wird. Am 17. Januar 1995 starben in der Millionenstadt Kobe 6394 Menschen durch ein schweres Erdbeben. Und Tokio "wartet auf seinen Tod", sagt Bill McGuire, Gefahrenforscher am Londoner University College. Zuletzt erschütterte am 1. September 1923 ein heftiges Erdbeben die Stadt, 142.000 Menschen kamen um. Seither steigt die Spannung im Gestein unter der Stadt unerbittlich an. Bei einem Starkbeben würden zahlreiche Brücken, Autobahnen und Hochhäuser zerstört, warnen Experten. Die Schäden könnten sich auf 2000 Milliarden Dollar belaufen, kalkulieren Versicherungen. Womöglich würden sogar die Finanzmärkte und damit die Weltwirtschaft in eine schwere Krise geraten. Um der Bedrohung nicht für alle Zeit wehrlos ausgesetzt zu sein, beschloss die japanische Regierung den Bau der "Chikyu". Die Gesteinsproben, die sie aus dem Meeresboden holen wird, sollen Aufschluss darüber geben, wie der sich in größeren Tiefen verändert. Vor allem aber wollen die Wissenschaftler in der Erdkruste Sensoren installieren, die Informationen aus Erdbebenherden übertragen, etwa über Mikrobeben und unterirdische Bewegungen des Wassers - Daten, die vielleicht zeigen, wie sich künftige Beben prognostizieren lassen.
Niemals zuvor haben Forscher in eine Erdbebenzone im Meeresboden gebohrt. Tatsächlich ist ein solcher Vorstoß heikel. So könnten Hitze und ätzende Flüssigkeiten das Bohrgestänge zersetzen. Außerdem besteht die - geringe - Gefahr, dass die Bohrung selbst Erdstöße auslöst. Und schließlich bedrohen natürliche Erschütterungen die Messgeräte im Bohrloch. Aber die "Chikyu" ist gewappnet. Das Schiff selbst dürfte kaum in Gefahr geraten, meint Achim Kopf, Meeresforscher an der Universität Bremen, der an einer Probefahrt teilnahm. Ein Seebeben würde schlimmstenfalls das Bohrgestänge brechen lassen. Im Notfall wird der Bohrstrang vom Schiff abgekoppelt. Das Ganze sei "ein kalkulierbares Risiko", meint Kopf. Das Forschungschiff kann sogar dort in die Tiefe dringen, wo Gas im Boden liegt. Bei älteren Bohrschiffen bestand die Gefahr, dass Gas explodiert und Bohrgestänge und Schiff zerstört. Um das zu verhindern, wird das Bohrloch mit einem 380 Tonnen schweren Sicherheitsventil abgedichtet. Außerdem ummantelt den Bohrstrang ein spezielles Rohr, ein sogenannter Riser. In ihm zirkuliert ein Spezialschlamm, der im Rumpf des Schiffes in gewaltigen Zisternen von mehreren Arbeitern stetig neu angemischt wird. Der Schlamm lastet auf dem Bohrloch und stellt sicher, dass sich der Druck im Loch nicht verringert - Explosionen bleiben aus.
Zusätzlich sorgt der Riser dafür, dass das Bohrloch stabil bleibt und dass es nicht von heißem Gestein in der Tiefe wie mit Knetmasse verschlossen wird. Es ist diese neue Technologie, dank derer die "Chikyu" auf späteren Expeditionen erstmals bis in den Erdmantel vorstoßen kann - in die Schicht zwischen Kern und Kruste. Unter den Kontinenten liegt die Grenze zwischen Kruste und Mantel meist mehr als 30 Kilometer tief im Boden. Unter den Ozeanen hingegen ist die Kruste mancherorts gerade zwei Kilometer dick - und damit für die "Chikyu" kein Problem. Forscher werden mithilfe des Schiffs ihre Annahmen über die Zusammensetzung und Konsistenz des Erdmantels überprüfen können. Sie hoffen, dass etwa die Mischung von verschiedenen Mineralien, von extrem zähflüssigem und erstarrtem Material ihnen Auskunft gibt über Geschwindigkeit und Rhythmus von Bewegungen im Erdmantel - und damit über den Ursprung von Erdbeben und Vulkanismus. In jedem Falle erkunden sie Neuland im wahrsten Sinne des Wortes. "Wir haben Steine vom Mond geborgen", sagt Meeresforscher Achim Kopf, "aber noch immer nicht aus dem Erdmantel."
Die Wissenschaftler müssen Geduld mitbringen
An Bord der "Chikyu" werden rund 50 Wissenschaftler auf den Sensationsfund warten. In Akkordarbeit untersuchen sie in verschiedenen Labors die Bohrkerne, die während der Prozedur per Fahrstuhl vom Oberdeck über vier Stockwerke hinab in den Schiffsrumpf gelangen, wo sie gelagert werden. Zunächst messen die Forscher entweichende Gase. Später durchleuchten sie die kostbaren Stangen im Computertomografen, analysieren ihre Struktur, bestimmen die eingeschlossenen Relikte von Organismen und die Korngröße sowie das Alter der Sandkörner. Geologen und Paläontologen rekonstruieren, in welcher Umwelt sich die Partikel einst abgelagert haben. Die Wissenschaftler schauen der Erde ins Tagebuch; längst untergegangene Welten werden gleichsam lebendig. Forscher wie Jörn Thiede, Meeresforscher am Alfred-Wegener-Institut für Polar- und Meeresforschung in Bremerhaven, glauben sogar, dass man kilometertief im Gestein tatsächlich auf Leben stoßen könnte.
Schließlich wurden in den vergangenen Jahren bereits 850 Meter tief im Meeresboden Bakterien gefunden. Wovon sie leben, ist vollkommen unklar. "Die Energiemengen in Form von organischen Substanzen reichen dort gerade dafür, dass sich die Bakterien einmal in tausend Jahren teilen - eine nicht realistische Teilungszeit", sagt Bo Barker Jørgensen vom Max-Planck-Institut für Marine Mikrobiologie in Bremen. Kreaturen in noch größerer Tiefe dürften ein Leben wie auf einem anderen Planeten führen, meint Jørgensen. Denn sie müssten unter höllischen Bedingungen leben, in großer Hitze und unter hohem Druck. Ihr Fund wäre fast so sensationell wie die Entdeckung von Leben auf dem Mars. Die Wissenschaftler, die sich nun aufmachen, den Grund der Erde zu erforschen, müssen Geduld mitbringen. Weil der Boden so hart und die Strecke so weit ist, werden die Tiefenbohrungen auf mehrere Projektabschnitte verteilt - und für jeden einzelnen davon muss die "Chikyu" monatelang über dem Bohrloch stehen.
"Es herrscht Arbeitsatmosphäre"
Für die jetzt beginnenden Bohrungen vor Japan sind mehrere Jahre angesetzt. Modernste Technik sorgt dafür, dass die "Chikyu" während der langen Einsätze nicht von Strömung oder Wellen abgetrieben wird. GPS-Satelliten helfen dabei, das 57.500 Tonnen schwere Schiff genau auf Position zu halten. Die Navigationssignale steuern sechs Propeller am Rumpf des Schiffes, die es präzise in jede Richtung bewegen können. Die Feuertaufe sei bestanden, berichtet James Austin, einer der wissenschaftlichen Leiter. Auf einer Probefahrt habe das Schiff während eines Taifuns in acht Meter hohen Wellen seine Position halten können. Der Alltag der Besatzung wird keineswegs vergnüglich sein. Forscher, die schon an Bord waren, berichten, dass die Räume spärlich eingerichtet, manche Labors geradezu düster seien. Der Konsum von Alkohol und Zigaretten ist verboten, überall muss Sicherheitskleidung getragen werden. Ablenkung gibt es kaum. "Es herrscht Arbeitsatmosphäre", sagt Achim Kopf. Aber das ist normal für Entdecker. Schließlich hatte die "Apollo 11" auch keine Bordbar.