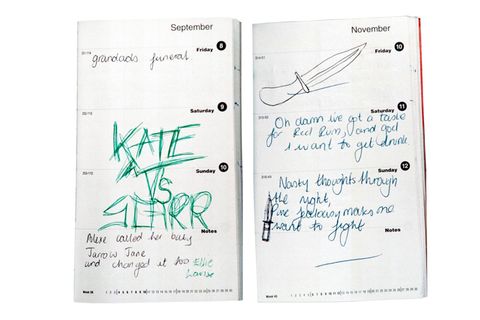Der Nanotechnik wird ein riesiges Potenzial zugeschrieben, obwohl bisherige Anwendungen vergleichsweise bescheiden anmuten. Das ist unter anderem das Verdienst berühmt gewordener Visionäre.
Schon vor 2500 Jahren formulierte der griechische Philosoph Demokrit die Atom-Hypothese: Alle Materie besteht aus kleinsten Einheiten, zwischen ihnen ist leerer Raum. Die Vielfalt der Natur entsteht durch die Kombination verschiedener Atome. Dies sei «die wichtigste und fruchtbarste Hypothese, die je über die Natur aufgestellt wurde», befand mehr als zwei Jahrtausende später der US- amerikanische Physiker Richard Feynman.
«There’s plenty of room at the bottom» («Dort unten ist eine Menge Platz»), prophezeite der spätere Nobelpreisträger Feynman im Dezember 1959 bei einem Vortrag, der heute als Startschuss der technischen Eroberung der atomaren Welt gilt. Wie klein, lautete seine Frage, lassen sich Maschinen bauen? «Kein Gesetz der Physik verbietet es, Dinge Atom für Atom zu bauen», verkündete Feynman seinem erlesenen Fachpublikum und sprach damit von Nanotechnologie, noch bevor das Wort überhaupt existierte.
Jede Vision braucht ihre Werkzeuge. Das Tor zur Welt der Atome stießen 1982 Gerd Binnig und Heinrich Rohrer im Schweizer IBM-Labor Rüschlikon auf: Sie entwickelten das Rastertunnelmikroskop, mit dem sich Atome nicht nur beobachten, sondern auch verschieben lassen. Vier Jahre später erhielten sie dafür den Nobelpreis.
Nahezu zeitgleich löste der Amerikaner Eric Drexler mit seinem Bestseller «Engines of Creation» (Schöpfungsmaschinen) ein Nano- Fieber aus, das bis heute anhält. Für Drexler steht der Einzug der Menschheit ins Schlaraffenland unmittelbar bevor. Die im Blut kreisenden Mini-U-Boote gehören ebenso zur Vision Drexlers wie die Nano-Assembler, die uns Atom für Atom jeden beliebigen Gegenstand zusammenbauen.
Bill Joy, als Mitbegründer des Computergiganten Sun Microsystems alles andere als ein Feind moderner Technik, hält eine friedliche Koexistenz von Mensch und Maschine dagegen für unmöglich. In seinem vor zwei Jahren veröffentlichten Aufsatz «Warum die Zukunft uns nicht braucht» kommt er zu dem Schluss, dass die Kombination von Robotik, Gentechnik und Nanotechnologie eine neuartige «Büchse der Pandora» öffnet. «Biologische Spezies haben nie den Kontakt mit überlegenen Konkurrenten überlebt», argumentiert er. Menschen als Zootiere der Nanomaschinen, die alle Materie der Welt zu Staub zermalmen, so sehen die Horror-Visionen des Computerexperten aus. Der Mensch als bedrohte Art, und das nicht etwa in 100, sondern schon in 30 Jahren. Einziger Ausweg Joy zufolge: der Verzicht auf Nano-Forschung.