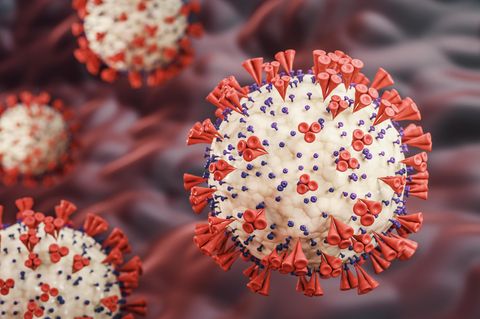Plötzlich ist der Teufel los. Flügel schlagen, wütendes Geschnatter, eine Ente zischt in Kniehöhe vorbei. Federn bleiben zurück, schweben in der Luft. Christian Senn schwingt den Kescher zum zweiten Mal und erwischt einen Stockentenerpel. Der Amtstierarzt aus dem Schweizer Kanton Thurgau steht mit Kollegin Iris Bachmann - sie ist die administrative Leiterin des Forschungsprogramms Constanze - in einem Gehege mit grünem Plastikteich und Hühnerverschlag. Der Zaun ist etwa zwei Meter hoch, ein grobmaschiges Netz deckt das Gehege ab. Zehn Enten drücken sich in eine Ecke. Blickt man durchs Gitter der Gehegetür, sieht man den Hof der Fischbrutanstalt Romanshorn und das Bodenseeufer. Es ist Montagmorgen und es ist Zeit, Proben zu nehmen. Constanze ruft.
Constanze: Das Forschungsprogramm
Der Bodensee ist eine Drehscheibe für Zugvögel. Im Frühling 2006 grassierte unter ihnen erstmals die gefährliche Vogelgrippe H5N1 Asia. Um diese Tierseuche besser zu verstehen und die Verbreitungsgefahr abzuschätzen, die dabei von Zugvögeln ausgeht, wurde nun das für Europa einmalige Forschungsprogramm Constanze auf die Beine gestellt. Es besteht aus mehreren Teilprojekten:
1. Überwachung: In drei Gehegen am Bodensee leben Wächterenten, die regelmäßig untersucht werden, ob sie mit dem Vogelgrippevirus in Kontakt kamen. Auch Wildvögel, die in Reusen auf dem See gefangen werden, sollen untersucht und anschließend unversehrt wieder in die Freiheit entlassen werden.
2. Vogelkunde: Welche Vogelarten halten sich wo am See auf? Seit Jahrzehnten werden die Wasservögel am Bodensee genau gezählt und erfasst. Nun wollen die Forscher Wildvögel zusätzlich mit kleinen Sendern ausrüsten, um festzustellen, welche Vogelarten Kontakt miteinander haben und welche Arten überhaupt die Geflügelpest in einen Hühnerhof tragen könnten.
3. Infektionsstudien: Im Schweizerischen Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe werden Schwäne und Schweine mit H5N1 infiziert, um herauszufinden, wie sich die Tiere anstecken, ob sie die Erreger ausscheiden und wie lange.
4. Risikomodell: Ein Computermodell, in dem die Ergebnisse aus Constanze sowie die Daten der regionalen Geflügelfarmen einfließen, soll Veterinärbehörden helfen, Schutzmaßnahmen zu planen.
5. Diagnostik: Im Schweizerischen Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe und im deutschen Friedrich-Löffler-Institut will man einen einzigen Bluttest entwickeln, mit dem alle verschiedene Vogelgrippetypen wie H5N1 oder H7N7 bestimmt werden können. Bislang sind hier verschiedene Tests notwendig.
Manche Entenarten überleben eine H5N1-Infektion, andere nicht
In diesem Gehege in Romanshorn in der Schweiz wird nach der Nadel im Heuhaufen gesucht - nach dem Vogelgrippevirus. Der Heuhaufen besteht aus 250.000 Wasservögeln, die den Winter am Bodensee verbringen. In Kontakt mit diesen Wildvögeln sollen unter anderem die flugunfähigen Stockenten in Romanshorn kommen. Sie könnten sich so die Vogelgrippe H5N1 einfangen. Das würden die Forscher dann bei ihren 14-tägigen Beprobungen feststellen. Dass Stockenten als sogenannte Wächterenten eingesetzt werden, hat seinen guten Grund: "Bei Infektionsversuchen im Labor hat man festgestellt, dass alle Tauchenten sehr rasch an Vogelgrippe sterben", sagt Wolfgang Fiedler von der Vogelwarte Radolfzell. "Dagegen überstehen manche Gründelenten, zu denen die Stockenten gehören, solch eine Infektion."
Constanze ist für Europa einmalig: Um festzustellen, wie viel Vogelgrippe-Risiko mit den Zugvögeln am Bodensee einfliegt, machen Österreich, die Schweiz und Deutschland, sechs Forschungsinstitute sowie Behörden gemeinsame Sache. "Aus meiner Sicht ist solch eine Zusammenarbeit spannend", sagt Christian Griot, Leiter von Constanze und Leiter des Schweizer Instituts für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe. Die drei Länder teilen sich die Gesamtkosten des Projekts von rund drei Millionen Franken (ca. 1,94 Millionen Euro). Die Ergebnisse der dreijährigen Forschungsarbeit sollen in ein Computermodell einfließen, mit dem sich das Risiko abschätzen lässt, das von Zugvögeln als Überträger der Vogelgrippe ausgeht. Die Frage dagegen, welchen Anteil Importe am Verbreiten der Vogelgrippe haben, beantwortet Constanze höchstens indirekt, indem sie die Zugvögel als Überträger abzuschätzen versucht.
Wo hält sich die Vogelgrippe zurzeit versteckt?
Vom großen Projekt zurück zur konkreten Arbeit: "Komm Spätzli", sagt Iris Bachmann hebelt vorsichtig den Schnabel auf, um ein Wattestäbchen in den Entenhals einzuführen. Ein zweites Wattestäbchen ist für einen Abstrich vom "Entenhintern" vorgesehen. Iris Bachmann fingert vorsichtig durch sehr dichtes Gefieder. Ergeben legt der Erpel seinen Kopf auf den Unterarm von Christian Senn und Iris Bachmann verschraubt das Wattestäbchen samt Abstrich in einem Röhrchen.
Wächterenten: lebende Alarmanlagen
Stockenten sollen am Bodensee Alarm schlagen, bevor die Vogelgrippe wütet wie im vergangenen Jahr. Tiere als Wächter oder lebende Alarmanlagen einzusetzen, ist keine neue Idee: Gänse auf dem Kapitol des alten Roms schlugen mit lautem Geschnatter Alarm und retteten die Stadt. Am Bodensee soll nicht Geschnatter, sondern ein Laborbefund die Menschen aus der Sorglosigkeit reißen. Und das funktioniert so: Die Wächtertiere leben in einem Gehege, in dem sie von Wildenten besucht werden, die die Vogelgrippe übertragen könnten. Den Wächterenten wurden die Flügel gestutzt, sie können nicht davonfliegen. Deshalb haben die Forscher alle zwei Wochen leichtes Spiel, wenn sie von den Wächterenten Proben nehmen. Im Labor wird dann festgestellt, ob die Tiere mit dem Vogelgrippevirus in Kontakt kamen.
Mit dieser Feldarbeit lässt sich vielleicht die Frage beantworten, ob sich die Vogelgrippe am Ende latent in Wildvögeln aufhält? Wo hält sie sich überhaupt zurzeit versteckt? "In der Schweiz und am Bodensee sehr wahrscheinlich nicht", sagt Christian Griot. "Aber wir kennen bislang nur tote Vogelgrippeopfer. Vielleicht sind die lebenden und überlebenden Wildvögel viel interessanter", sagt er. Denn sie könnten die Vogelgrippe verbreiten und Nutzgeflügel anstecken.
Chinesische Forschungsergebnisse sind mit Vorsicht zu genießen
Es gibt Hinweise, dass sich die Tierseuche unter anderem auch über Wildvögel verbreitet: Ausbrüche der Vogelgrippe lassen sich in einigen Fällen mit Zugrouten von Wildvögeln in Deckung bringen. Und es existieren Laborversuche, bei denen Enten mit Vogelgrippe infiziert wurden, dabei gesund blieben und Viren ausschieden. In diesem Zusammenhang wird auch meist eine Forschungsarbeit zitiert, bei der Tausende Proben am Poyang-See in China genommen wurden. "Sechs lebende Wildvögel fand man dort, die H5N1-Viren ausschieden", sagt Wolfgang Fiedler. "Diese sechs Tiere werden unter anderem als Beweis herangezogen, dass Wildvögel die Vogelgrippe in freier Wildbahn überleben und sie verbreiten können." Fiedler hat sich vor kurzem persönlich am Poyang-See umgesehen: "Man muss diese Forschungsergebnisse vermutlich mit Vorsicht genießen. Sie sind lausig dokumentiert."
Der Zweifel und Fragen nicht genug: Es existiert nicht einfach ein Vogelgrippevirus H5N1, es gibt mehrere Linien dieses Virus'." Auf Rügen schlug im Frühling 2006 eine andere H5N1-Virenlinie zu als am Bodensee. "In Afrika hat man drei Virenlinien gefunden", erklärt Fiedler. "Zwei wurden wahrscheinlich über Geflügeltransporte eingeschleppt." Die dritte könnte mit Zugvögeln vom Schwarzen Meer eingereist sein. "Aber warum hat man in Afrika nur sehr wenige an Vogelgrippe verendete Wildvögel gefunden?" Warum starb im Sommer ein Trauerschwan im Dresdner Zoo an H5N1? Warum nur er und nicht auch seine Artgenossen? Und warum nicht die anderen Vögel, die mit ihm am selben Teich lebten?
Zurück an den Bodensee zu Iris Bachmann. Sie lässt die Schnallen der Kühlbox zuschnappen. Darin zwei Mal elf Tupferproben. Sie hat auch allen Wächterenten Blut abgenommen. Diese Proben wandern in einen Pappumschlag. Per Nachtexpress werden sie nun zum Institut für Viruskrankheiten und Immunprophylaxe geschickt.
Wolfgang Fiedler erschrickt kurz die elf Wächterenten von Romanshorn. Ihn interessiert, ob sie wirklich flugunfähig sind. Er ist zufrieden: Die Tiere schimpfen, aber sie fliegen nicht auf. Nun müssen möglichst viele Wildvögel zu Besuch kommen. Verlockendes Futter steht deshalb für sie bereit. Die Nadel im Heuhaufen muss sich doch finden lassen.