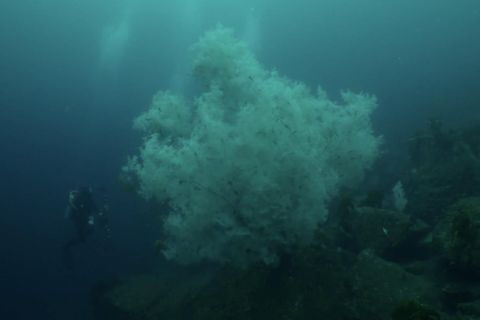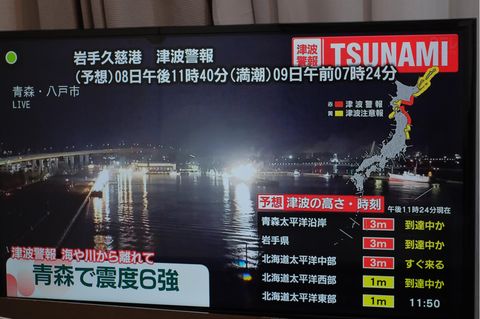Auf den Jahrestagungen der Internationalen Walfangkommission (IWC) kommt es immer wieder zu absurden Szenen. Wissenschaftler aus Japan legen dann ihren Kollegen aus den anderen Mitgliedstaaten ihre neuesten Erkenntnisse aus dem sogenannten wissenschaftlichen Walfang dar. "Da schneiden sie die Mägen auf, und dann sind da immer Fische drin und doch keine Wiener Würstchen", sagt die deutsche Meeresbiologin Petra Deimer kopfschüttelnd. Vom 23. bis zum 27. Juni tagen die Experten der IWC in Santiago de Chile.
Die von Japan angeblich zu wissenschaftlichen Zwecken betriebene Waljagd sei ganz eindeutig ein Mittel, das seit 1986 bestehende Verbot des kommerziellen Walfangs zu umgehen, sagt Deimer, die für Deutschland im IWC-Wissenschaftsausschuss sitzt. So seien auch im vergangenen Jahr wieder mindestens 1000 Wale in japanischen Kochtöpfen gelandet.
Kein Kompromiss in Sicht
An dem jahrelangen Patt zwischen dem Lager der Walfang-Befürworter um Japan, Norwegen und Island sowie den Walschützern unter den insgesamt 80 IWC-Unterzeichnerstaaten dürfte sich auch auf der diesjährigen 60. Jahrestagung nichts ändern. Keine Seite habe die notwendige Dreiviertelmehrheit, um einschneidende Änderungen durchsetzen zu können, sagt Deimer. So dürfen die Befürworter der Waljagd den kommerziellen Walfang zwar nicht ausbauen, doch die Walschützer könnten auch nichts gegen den noch praktizierten Walfang bewirken. Dennoch, das Walfang-Moratorium sei selbst in dieser eingeschränkten Form ein großer Erfolg.
Dem stimmt auch der Chef der deutschen Sektion der internationalen Wal- und Delfinschutzorganisation WDCS, Nicolas Entrup, zu. "Vor Beginn des Walfang-Moratoriums wurden pro Jahr schätzungsweise 13.000 Wale weltweit getötet, und heute liegen wir zwischen 1000 und 2000." Insofern sei das Moratorium ein Erfolg, wenn man es daran misst, dass es hunderttausenden von Walen über diesen Zeitraum das Leben gerettet habe. Entrup bezeichnet das IWC-Abkommen dennoch als "zahnlosen Tiger", da zur Durchsetzung des Walschutzes keinerlei Druck ausgeübt oder Sanktionen festgesetzt werden könnten.
Die Zahl der Wale sei seit Beginn des Moratoriums zwar wieder gewachsen. Genaue Angaben gebe es jedoch nicht, weil sich die Tiere auf offener See nicht eindeutig zählen lassen. Den Walfangnationen wirft Entrup vor, weit überhöhte Schätzungen zu nennen, um so die Jagd auf die Tiere zu rechtfertigen. Trotz des seit 22 Jahren bestehenden Walfangverbots seien viele Populationen noch immer vom Aussterben bedroht: Früher, also vor dem Beginn der massiven Jagd um 1920, habe es etwa zehnmal so viele Wale in den Weltmeeren gegeben wie heute, sagt Deimer.
Es geht auch um Stolz
Die Walschützer lehnen einen zurzeit diskutierten Kompromiss mit den Walfangnationen ab. Dabei würde Japan auf den als Wissenschaft deklarierten Walfang verzichten, dafür aber die Erlaubnis für einen eingeschränkten "Küstenwalfang" in seiner 200-Meilen-Zone erhalten. Japan beruft sich bei dem Ansinnen auf das Recht indigener Bewohner der Küsten Alaskas und Russlands, eine geringe Zahl Wale zur traditionellen Selbstversorgung zu töten. Japanische Walfänger seien jedoch nicht zur Erhaltung ihrer speziellen Lebensweise auf den Walfang angewiesen, argumentiert Deimer.
Das zähe Festhalten Japans, Norwegens, und Islands am Walfang sei nur schwer erklärlich, sagt Entrup. Als einziger wirklicher Markt für Walfleisch gelte Japan. Wirtschaftlich sei der Walfang nur noch möglich, weil er stark subventioniert werde. Hinzu komme aber auch, dass die Regierungen Angst hätten, ihr Gesicht zu verlieren. Vor allem Japans Haltung laute, "wir lassen uns von außen nichts sagen".