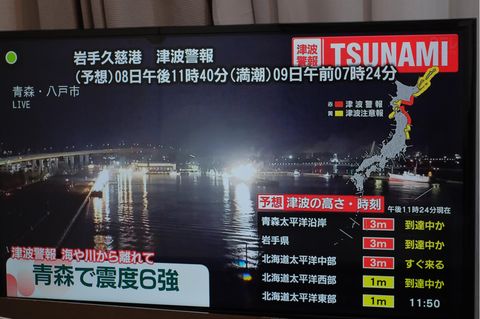Diese Schuhe. Es müssen diese Schuhe sein diesen Sommer. Mit kugelschreiberhohem Absatz und feinen Riemchen, klapperlaut, für über 280 Mark das Paar. Ohne diese Schuhe geht gar nichts in den Szenevierteln von Tokio. Dazu gehört der beige-braune Safari-Look, wahlweise der Altkleider-Trend: Hosen, angeschmutzt ab Fabrik, die knapp über der Hüfte enden, unpraktisch, aber überlebensnotwendig. Vor vier Monaten ging nichts ohne Plastikplateauschuhe, monatelang haben die Mädchen das Laufen auf den 15-Zentimeter-Klötzen geübt, sind über die vierspurigen Kreuzungen gestolpert und die engen Treppen der Kaufhäuser hinuntergewankt. Yumiko liebte ihre Plateauschuhe. Schlank machten sie, und groß fühlte sich die 18-Jährige. Bei 155 Zentimeter Körpergröße ist das wichtig. Aber wie alle Trends hielt auch dieser nur knapp ein halbes Jahr.
Nun stöckelt Yumiko in Stiletto-Sandalen mit Freundinnen ins Nudel-Schnellrestaurant. Die Zehen glänzen perlmuttfarben, die Fingernägel schimmern blau. Stundenlange Arbeit war das. Eigentlich sollte Yumiko darüber nachdenken, was sie mit ihrem Leben anfangen will. Will sie aber nicht. Lieber spaziert sie in den Szenevierteln Shibuya und Shinjuku herum, eingehakt bei den Freundinnen. Das rosa Mobiltelefon ist vollgehängt mit Glitzerbändern, Stofftierchen und Popstar-Stickern. Wenn es fünf Minuten nicht piept, schaut Yumiko, ob es noch an ist. Sie will Spaß, und zwar jetzt und nicht erst später, später, immer später, wenn sie erst mal funktioniert hat im Rädchenwerk des japanischen Ausbildungssystems.
Ginge es nach ihren Eltern, sollte Yumiko für das Eintrittsexamen der staatlichen Universitäten büffeln: Auswendig die grammatikalische Struktur von englischen Sätzen hersagen, die sie gar nicht versteht, mathematische Formeln aufschreiben, die sie nie wieder anwendet. Stundenlang in der Paukschule, danach zu Hause bis in die Nacht. Wie es ihre Schwester getan hat, ein Jahr lang, acht Stunden am Tag.
12000 Mark für Privatunterricht
Yumikos Eltern hatten das Geld schon zur Seite gelegt für den Privatunterricht, 12000 Mark im Jahr. Die Mutter hat extra eine Kinderkrippe aufgemacht, um etwas dazuzuverdienen. Denn nichts ist wichtiger in Japan als die richtige Schule und dann die richtige Universität für die richtige Arbeit hinterher: den lebenslang gesicherten Job bei Sony, Honda, Matsushita.
Yumiko geht lieber surfen. Am Wochenende im Meer vor Tokio; unter der Woche auf der neuesten Modewelle beim Einkauf im Gewühl der Innenstadt. Sie lässt sich treiben, schaut nach den schrägsten Klamotten, den kleinsten Handys, den teuersten Handtaschen. Und die Freundinnen sind immer dabei. »Eine Louis-Vuitton-Tasche ist der Lebenstraum eines jeden Mädchens«, sagt Yumiko. Köchin will sie werden. »Vielleicht. Oder was mit Design. Multimedia wäre auch nicht schlecht.« Yumikos Mutter hat mit ihr gestritten, war wütend und auch ein bisschen ängstlich, weil ihre Tochter nicht wollte, wie sie sollte, wie sie musste. Aber weshalb sollte Yumiko büffeln wie blöde, wenn am Ende der gute Job nicht gesichert ist?
Horrorgeschichten machen die Runde: Freundinnen haben sich 40-mal beworben - vergebens. 20 Prozent der Uni-Absolventen finden keinen Job, die großen Firmen entlassen Mitarbeiter. Zehn Jahre Konjunkturflaute treffen die junge Generation, und die fragt sich, ob sie noch mitmachen soll bei der Japan GmbH.
Teilzeit-Teenager
»Freeter« werden die Teilzeit-Teenager genannt, nach dem englischen »free« und dem deutschen »Arbeiter«. Jeder zehnte Japaner zwischen 19 und 30 Jahren hüpft inzwischen von einem Job zur nächsten Jeans zum nächsten Job zum nächsten Bali-Urlaub. Sie wechseln ihre Arbeitsstelle mehr als einmal im Jahr, verdienen gerade genug für die Handyrechnung und das richtige Outfit. Sie leben noch zu Hause. Teilzeitjobs sind die einzigen Stellen, deren Zahl ständig zunimmt in der krisengeschüttelten Wirtschaft.
Auch Yumiko lebt noch im Hotel Mama. Ihre Eltern zahlen für Surfbrett, Metro-Ticket und Friseur. Sie jobbt in einem Restaurant und in der Tageskrippe ihrer Mutter: »Niemals könnte ich so hart arbeiten wie meine Schwester«, sagt Yumiko. »Und wie mein Vater auch nicht.« Für Freeters gibt es nichts Uncooleres als die Lebensweise der Älteren. Sie sehen die Väter im Morgengrauen in der U-Bahn entschwinden und in der Nacht wieder heimkehren - oft betrunken von Betriebsausflügen, denen ein verantwortungsbewusster Mitarbeiter nicht entgehen kann. »Die Eltern scheinen ihr Leben nicht zu genießen«, sagt
Futaba Tanaka, Jugendforscherin der zweitgrößten Werbeagentur Japans, »Hakuhodo«. Der Traumberuf der glorreichen japanischen Wirtschaftsjahre, der »Salaryman«, wird zur Witzfigur. »Oyaji« werden die Alkoholleichen in den Vorortzügen genannt, alte Knacker.
Ihre neuen Vorbilder finden die Jungen in den Einkaufspassagen, fein gesteuert von den Trendmeldungen der Jugendmagazine und TV-Shows. Zum Beispiel Reiko Nakane. Sie war ein Popstar zum Anfassen, ein »Charisma Girl«. Was die Techno-Barbiepuppe trug, trugen ihre Kundinnnen zur Kasse und bescherten der Boutique »Egoist« zwei Millionen Dollar Umsatz - monatlich. Mädchen fragten Reiko, was sie anziehen, wer sie sein sollten.
Ganguro-Sein war Lebensinhalt: Mit weißer Augenbemalung auf sonnenbankgebäunter Samthaut wedelten sie in den Discotheken zu Technoklängen nur noch mit den Händen, hoch konzentriert, militärisch fast die simultanen Bewegungen. 300 verschiedene Bewegungsabläufe gibt es, jeder muss genau memoriert werden aus Magazinen oder von Videobändern, 70 Mark das Stück. Die Mädchen standen in den Discos auf Podesten, balancierten auf ihren Plateauschuhen, um einmal Mittelpunkt zu sein. Wer eine falsche Handbewegung machte, war draußen.
Reiko Nakane machte die Kette »Egoist« zur erfolgreichsten Modeboutique Japans. Für ein paar Monate. Nun kommen kaum noch Fernsehcrews oder Schulmädchen, die sich mit Nakane fotografieren lassen. Weder Yumiko noch ihre Freundinnen tragen weiter »Egoist«. »Eigentlich«, flüstert Yumiko, »eigentlich ist die Nakane ziemlich alt.« Sie ist 22.
»Die Kids sind furchtbar schnell gelangweilt«, sagt Atsushi Shikano, Chefredakteur des Musikmagazins »Rockin? On Japan«. »Und sie leben in einem absoluten Chaos.« Er bekommt jeden Monat Hunderte Briefe verzweifelter Leser, die darum betteln, dass jemand ihnen sagt, wie, verdammt, sie ihr Leben meistern sollen. »Wir sind fast ein religiöses Institut geworden«, sagt Shikano. Er beantwortet keinen der Briefe: »Unsere Philosophie steht in unserem Magazin. Ich kann niemandem sagen, wie er sein Leben führen soll.«
Blutbeschmierte Krankenschwesterkittel
»Schamlos«, murmeln Fußgänger angesichts der Teenager auf der Brücke vor dem Meiji-Schrein. Vor dem Tempel tummeln sich Mädchen mit blauen Haaren und blutbeschmiertem Krankenschwesterkittel, angezogen wie die Jungs ihrer Lieblingsband »Glay«. Die älteren Japaner müssen mit ansehen, wie sich das besondere japanische Lebensgefühl auflöst: das Leben in einer Gemeinschaft mit gemeinsamen Zielen. Doch, fügen sie an, sie trügen selbst auch Schuld am Niedergang der Sitten. Denn sie hätten über der Jagd nach Geld und Sicherheit vergessen, der jetzigen Elterngeneration Werte mitzugeben.
Hoffnungslosigkeit, nennt das Ryu Murakami, Schriftsteller und Regisseur von »Tokyo Decadence«. Sein neuer Roman handelt von Jugendlichen, die in den äußersten Norden auswandern und dort ein Utopia aufbauen, weil die Leere der japanischen Konsumgesellschaft sie ankotzt. Ein Traum, sagt er. In Wirklichkeit sei die Jugend ohne Zukunft. Der wirtschaftliche Abstieg in den neunziger Jahren habe gezeigt, dass die japanische Gesellschaft unter dem Mantel des Wohlstandes kraftlos geworden ist. »Was einst ein großer Fels war, ist zerfallen in kleine Steine.«
Die meisten Japaner haben Angst, ihre Identität zu verlieren, eine Identität, die sie laut Ryu Murakami schon lange nur noch über Einkaufstüten definieren. Das hat auch die Werbung begriffen. So verteilt Adidas in ganz Tokio Plakate mit einem Fußballstar und dem Satz »We are Japanese«. Japaner, die versuchen, der Enge Nippons zu entkommen, zieht es immer wieder zurück in ihre Heimat, in ein Land, das vor der großen Frage steht: Zusammenbruch oder Aufschwung? Joichi Ito, der Gründer der Internetfirmen »Digital Garage« und »Infoseek Japan«, hat gerade seine amerikanische Green Card zurückgegeben. Er will da sein, in Tokio, wenn es losgeht: »Die wirklich großen Firmen werden nicht im Aufschwung, sondern unter Schwierigkeiten gegründet.« Er ist bereit.
Masayuki Mogi ist aus Paris zurückgekehrt, um Köpfe zu verändern. Das, sagt der ehemalige Kreativ-Direktor bei Vidal Sassoon, sei seine Mission: die Japaner zu befreien vom geraden, schwarzen Bob-Haarschnitt der Hemdenträger und
Bürodamen. Er hat angefangen, ihre Haare fransig zu schneiden, und er brachte die Farben mit. Heute färbt jeder, der etwas auf sich hält, seine Haare straßenköterblond oder braun-rot. »Wir machen unsere Kunden unabhängig«, sagt Mogi.
Bei Mogi zu arbeiten ist hip, hier wacht kein Chef über Arbeitszeiten, hier entscheiden nicht das Alter und die Jahre im Betrieb über die Beförderung. »Unsere Angestellten sind unsere Partner«, sagt er. Mogi wählt seine Mitarbeiter aus Hunderten von Bewerbern aus. Friseur ist einer von zehn Lieblingsberufen der Jugendlichen, denn die Besten sind wie Popstars und haben ihre eigenen Fernsehshows.
»Löwenmähne« als Dauerthema
Die graumeliert-gewellten Haare des japanischen Premierministers Junichiro Koizumi sind Dauerthema in Japan. »Löwenmähne« wird er liebevoll genannt. »Sein Haar zeigt die Freiheit, die er sich nimmt. Die Leute sollten auf ihn hören«, sagt Masayuki Mogi. Der erste fernsehtaugliche Premier Japans schwimmt auf einer Welle der Zustimmung, zwei Millionen Menschen haben seinen E-Mail-Rundbrief abonniert, eine CD mit seiner Lieblingsmusik erscheint demnächst. Koizumi ist ein Popstar. Bei der Wahl am Sonntag hat seine Liberaldemokratische Partei LDP zum ersten Mal seit neun Jahren Mandate
dazugewonnen und die Mehrheit der Regierungskoalition im Oberhaus ausgebaut. Ob ein Popstar mit den 12000 Milliarden Mark Staatsverschuldung und der drohenden Rezession umgehen kann? Koizumi hat einen Ruf wie noch kein Premier in Japan vor ihm: Dass er sagt, was er meint.
10000 Plakate mit seinem Konterfei werden pro Tag verkauft, die Tassen mit seinem Porträt müssen in den Souvenirläden ständig nachbestellt werden. »Er streitet sich wie ein normaler Mensch«, sagt Yumiko. Seit er gewählt wurde, schauen sie und ihre Freundinnen zum ersten Mal in ihrem Leben Parlamentsdebatten im Fernsehen. »Er ist süß«, sagen sie. Warum sich Yumiko die Debatten anschaut? »Aber das tun doch alle«, sagt sie und lacht. »Er ist in.«
Cornelia Fuchs