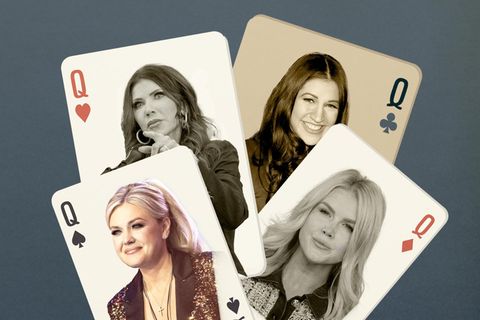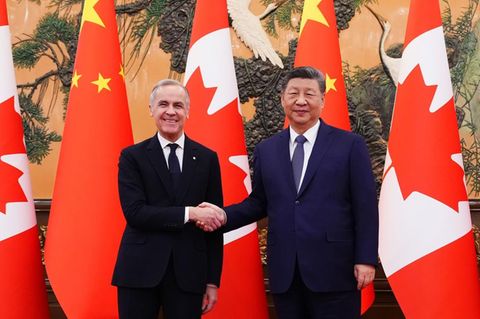Der Pekinger Büroangestellte Wang Hao sitzt mit einem Kollegen beim Mittagessen zusammen. Sie schaufeln das Essen mit Wegwerfstäbchen aus einer Plastikschale. Anstatt in ein Restaurant zu gehen, haben sie sich eine Lunchbox von einem Lieferservice bestellt. Das kostet jeden von ihnen nur acht Yuan, rund 90 Eurocent.
Wang Hao will sparen, sein Ziel: unter der Woche nicht mehr als 100 Yuan, umgerechnet 11,50 Euro, auszugeben. Bis letzten Juni war der smarte 24-Jährige mit dem schwarz-weiß gestreiften Pullunder über weißem Hemd und der modischen schwarzen Brille ein typisches Beispiel der chinesischen Generation Wirtschaftswunder. Wie seine Altersgenossen aus der wachsenden chinesischen Mittelklasse machte er sich wenig Gedanken darum, wie viel er ausgab. "Ich habe mir alle sechs Monate ein neues Handy gekauft", erzählt Wang Hao. Fast täglich ging er mit Freunden in schicken Restaurants essen, am Wochenende trafen sie sich in Clubs und Karaoke-Bars. Am Ende des Monats war von seinem für chinesische Verhältnisse recht guten Gehalt von 5000 Yuan - knapp 600 Euro - nie etwas übrig. Jetzt will er seine Ausgaben drastisch herunterfahren, so wie viele Chinesen es angesichts der Wirtschaftskrise tun müssen.
Die Krise hat China nicht nur wegen der schwächelnden Exportmärkte in den USA und Europa kalt erwischt, sondern ist zum Teil hausgemacht. In der Euphorie während der Vorbereitung zu den Olympischen Spielen in Peking verspekulierten sich chinesische Investoren und verloren viel Geld, als die Blase schließlich platzte und einen Domino-Effekt auslöste.
Sparen mit Spaß dabei
Wang Haos Sparwut hatte mit der Wirtschaftkrise zunächst nichts zu tun. Im Sommer 2008 hatte er ein Apartment gekauft und musste plötzlich 2500 Yuan monatlich für den Kredit zurücklegen. Da kam ihm die Idee mit der 100-Yuan-Woche. Seitdem fährt er mit der U-Bahn zur Arbeit; das kostet ihn nur zwei Yuan pro Fahrt, anstatt zehn Yuan mit dem Taxi. Und zur Freude seiner Freundin hat er sogar kochen gelernt und macht es sich zum Abendessen mit ihr auf dem Sofa daheim gemütlich. Täglich notiert er seine Ausgaben im Computer.
Damit die Sparerei zumindest Spaß macht, begann er auf seinem Blog darüber zu schreiben und rief andere zum Mitmachen auf. Sein "100-Yuan-pro-Woche"-Club bekam erst nur wenig Zulauf, aber seit die Wirtschaftskrise Ende 2008 auch in China voll eingeschlagen hat, ist die Mitgliederzahl auf mittlerweile über 50.000 Pfennigfuchser gestiegen. Sie tauschen Tipps zum Sparen aus, bilden Fahrgemeinschaften zur Arbeit oder verabreden sich für Freizeitaktivitäten zu Hause, die wenig kosten.
"Es geht nicht nur darum zu sparen", erklärt Wang Hao, "sondern auch um Lebensqualität zu geringeren Kosten." Fahrrad statt Autofahren, gesundes, günstiges Essen statt opulente Mahlzeiten und teures Fast Food. Mittlerweile werben weitere ähnliche Internetangebote mit steigenden Nutzerzahlen für eine neue Tugend des Sparens unter der jungen, städtischen Mittelschicht Chinas.
Konsumieren für das Wohl der Nation
Soviel Sparsamkeit dürfte die Regierung nicht sehr erfreuen. Sie muss den Binnenkonsum ankurbeln, um die acht Prozent Wirtschaftswachstum zu erreichen, die sie für 2009 als Ziel gesteckt hat. So viel halten chinesische Experten für nötig, um den sozialen Frieden zu sichern und Jobs für die über 15 Millionen Menschen zu schaffen, die jedes Jahr neu auf den Arbeitsmarkt drängen. Die Regierung fürchtet nichts mehr als soziale Unruhen, wie sie bereits die großen Industriegebiete in Südchina gesehen haben. Dort mussten schon viele Fabriken schließen und die Arbeiter protestierten zu Tausenden.
Dem findigen Sparfuchs Wang Hao ist auch zum Konsumaufruf der Regierung etwas eingefallen. Er hat auf seinem Blog eine neue Kampagne gestartet, in der er die Nutzer aufruft, freiwillig zwischen einem und zehn Yuan auf sein Konto zu spenden. Wenn er 100.000 Yuan gesammelt hat, will er damit ein Auto oder ein zweites Apartment kaufen und so etwas zur Konsumsteigerung beitragen. 4000 Yuan - etwa 460 Euro - hat er schon zusammen.