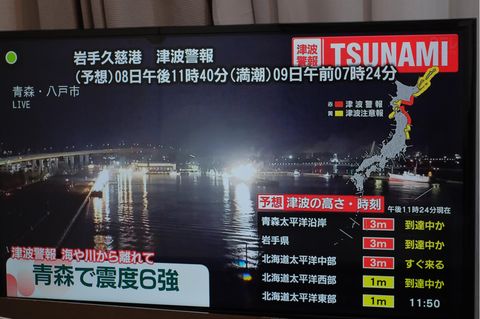Nur langsam wird das ganze Ausmaß der Zerstörungen durch das größte Erdbeben in Marokko seit Jahrzehnten deutlich. 2862 Tote und über 3000 Verletzte zählte das Innenministerium in Rabat bisher, und je weiter die Retter in die entlegenen Dörfer des Atlasgebirges vordringen, desto höher steigen die Zahlen.
Nach mehreren leichteren Nachbeben übernachten immer noch Tausende Menschen rund um die Touristenmetropole Marrakesch vor ihren Häusern und Wohnungen auf der Straße. In der Stadt ist hingegen überraschend schnell der Alltag zurückgekehrt. In der Innenstadt und in den Straßen des Geschäftsviertels erinnern nur die langen Konvois von Lkws mit Hilfsgütern daran, welche Tragödien sich in der Medina und der Hochebene südwestlich der Stadt abspielen. Die Laster sind mit privaten Spenden, Lebensmitteln und Zelten beladen. Aber hier in Marrakeschs Geschäftsviertel sind großen Schaufenster der Modeläden oder auch die aufwendigen Reliefs an der Bahnhofsfassade ebenso unbeschädigt wie die während des Touristenbooms der letzten Jahrzehnte entstandenen zahlreichen Neubauten am Stadtrand.
Ungewisse Zukunft
Es ist ein seltsames Bild angesichts der Nachrichtenlage: Die Cafés und Hotels sind voller Gäste, auch viele der internationalen Touristen scheinen in der Stadt geblieben zu sein. Erst ein Gang in die Medina, die Altstadt, zeigt ein ganz anderes Bild. Auf der Djemaa el fna, dem Marktplatz, der normalerweise Besucher aus aller Welt anlockt, ist schweres Räumgerät im Einsatz. Helfer des Roten Halbmonds und der marokkanischen Armee suchen nach Überlebenden. Das Minarett der berühmte Moschee ist auf die Straße gestürzt. Und viele der oft mehrere Jahrhunderte alten Häuser in der südlichen Medina sind wie Kartenhäuser in sich zusammengefallen.
"Ich dachte, ein Flugzeug sei abgestürzt", sagt Mohamed Lagar, ein Kioskbesitzer. Sein kleiner Laden befindet sich in einer der schmalen Gassen, die von der Djemaa el fna in das Labyrinth der eng zusammenstehenden Häuser führt. Nun graben Feuerwehrleute nach seinen Nachbarn, die unter einer zwei Meter hohen Schicht von Ziegeln und Steinen liegen könnten. "Ich habe sie seit Freitag nicht mehr gesehen. Vielleicht sind sie in einem Krankenhaus", sagt Lagar und schaut auf ratlos auf den Trümmerberg. Doch er scheint seinen Worten selbst nicht zu glauben.
Bis Freitag war die Medina von Marrakesch der Inbegriff der Magie des Orients. Geschichtenerzähler, Schlangenbeschwörer, all das faszinierte die Gäste aus dem Ausland. Nun schlafen hier auf dem Platz Hunderte Familien, aus Angst vor Nachbeben und weil sie alles verloren haben. "Ich weiß nicht, wie es weitergehen soll, denn Geld, um mein Haus wiederaufzubauen, habe ich nicht", sagt die 75-jährige Fatima, deren Familie in Casablanca sie nun zu sich holen will. "Die Moschee und die Medina sind doch das Herz des Landes, unsere Identität", sagt sie und weint.
Auch einige ihrer Nachbarn sind unter den Vermissten. Das Beben hat vor allem die Alten und Armen getroffen – und eben die Bewohner der Bergdörfer des Atlas. Eine Fahrt dorthin zeigt, warum die Regierung bisher nur Hilfsangebote aus vier Ländern angenommen hat: Spanien, Katar, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Diese Länder unterstützen Marokko auch im Konflikt um die Westsahara. Hilfe aus Frankreich, wo mehrere Millionen marrokanischstämmige Menschen leben, wurde hingegen abgelehnt.
"Je höher wir kommen, desto grausamer sind die Folgen des Erdbebens"
Aber hier im Atlas zeigen sich auch die logistischen Probleme, die Flaschenhälse, durch die die Hilfe hindurchmuss. Die Bergstraßen sind eng, selbst die mit Wasser und Notrationen beladenen Transporter der Armee winden sich nur im Schneckentempo um die engen Kurven. Große Felsbrocken und ausgerechnet die riesige Solidaritätswelle behindern die Retter. Stoßstange an Stoßstange stehen private Fahrzeuge im Stau, fast alle beladen mit Spenden aus dem ganzen Land. Soldaten versuchen Ordnung in das Chaos zu bringen. Die Dörfer der Provinz Al Haouz, 75 Kilometer südwestlich von Marrakesch, scheinen am stärksten betroffen zu sein, aber in viele Bergdörfer der Bezirke Ouarzazate, Azilal, Chichaoua und Taroudant haben es die Rettungskräfte noch gar nicht geschafft. "Je höher wir kommen, desto größer und grausamer sind die Folgen des Bebens", sagt ein von den Erlebnissen der letzten Tage sichtlich gezeichneter Armeeoffizier, während er einen mit Trinkwasser beladenen Armeelastwagen am Stau vorbeidirigiert.
Auch ausländische Helfer wären hier wohl nicht schneller vorwärtsgekommen – doch der Frust darüber, dass so wenig Hilfe bislang in die Dörfer gelangt ist, ist ihm anzumerken: "Während in Marrakesch schon bald wieder neue Touristen eintreffen, wird es in diesen Bergdörfern wohl auf absehbare Zeit keine Zukunft geben."
Der Geruch von Verwesung
Das Beben hat soziale Gräben weiter vertieft, zwischen denen in der Stadt, die auch vom Touristenboom profitieren – und den Armen auf dem Land. Der 70-jährige Schafhirte Ahcan Ait Majid irrt an den eingetroffenen Fahrzeugen der Helfer aus Marrakesch vorbei. In dem Dorf Tinisikt, seiner Heimat, haben nur wenige überlebt. Majid hat bei dem Beben seine Frau und zwei Söhne verloren. "Ich habe nichts Derartiges erlebt, wir haben ein ruhiges und friedliches Leben gelebt", sagt er wie noch immer unter Schock. "Ich weiß nicht, was ich jetzt tun werde."
In Tinisikt stehen nur noch die Betonmauern der Moschee. Die Hauptstraße ist von den Trümmern der Lehm- und Tonhäuser übersät. Hier liegen ganze Lebensgeschichten: Postkarten, ein Poster, Kinderkleidung.
Von der Armee evakuierte Dorfbewohner kehren gerade aus ihrem Zeltlager zurück. Sie versuchen ein paar Möbel aus den Häusern zu retten. Andere, wie Ahcan Ait Majid, stehen einfach auf der Straße und weinen. Über dem Dorf hängt wie überall in der Gegend ein Geruch von Verwesung.
Welle der Solidarität
Armeesoldaten bitten die Rückkehrer höflich, sich von den Trümmern ihres Lebens fernzuhalten. Schon leichte Bewegungen könnten Retter und Suchende unter dem Schutt begraben. Die Überlebenden von Tinisikt schlafen zusammen mit Familienmitgliedern in Zelten am Straßenrand. Unter einfachen Planen liegen 50 Menschen eng zusammen. Ärzte, Krankenschwestern und Sozialarbeiter werden aus Rabat, Agadir und Casablanca mit Helikoptern eingeflogen. Weiter in Richtung Ebene, in einem Feldlazarett der Armee auf halben Weg zwischen Tinisikt und Marrakesch, treffen immer weitere Verletzte ein. Oberst Yussuf Quamus steht vor einer Reihe von Zelten. Kritik an der Ablehnung ausländischer Unterstützung oder wegen zu langsamer Hilfe lehnt er ab. "Wir wissen, was wir tun. Sie sehen ja, dass man sich hier in den Bergen auskennen muss, um helfen zu können. Doch die große Herausforderung wird es sein, den Überlebenden wieder eine Zukunft in ihren Dörfern zu geben."
Ausnahmezustand in Marokko – die verzweifelte Suche nach den Verschütteten geht weiter
Marokkos König Mohamed IV. hat bereits einen Fonds angekündigt, mit dem die Dörfer des Atlas wiederaufgebaut werden sollen. Er war erst 18 Stunden nach dem Beben von seinem Aufenthalt in Frankreich zurückgekehrt. Der Monarch trägt in Frankreich den Spitznamen "König wider Willen". Er verbringt viel Zeit in seinem Schloss in Betz im Nordosten von Paris, das sein Vater Hassan II. 1972 erworben hat. Bis zum Montag reisten auch keine führenden Regierungsmitglieder ins Katastrophengebiet.
Doch die Solidaritätswelle der Marokkaner übertönte bisher die negativen Stimmen dazu weitgehend. Kritik am König oder an der Regierung ist in dem Erdbebengebiet kaum zu hören, zumindest nicht gegenüber ausländischen Journalisten. Es sei die Stunde der Solidarität, das wird jetzt immer wieder betont.