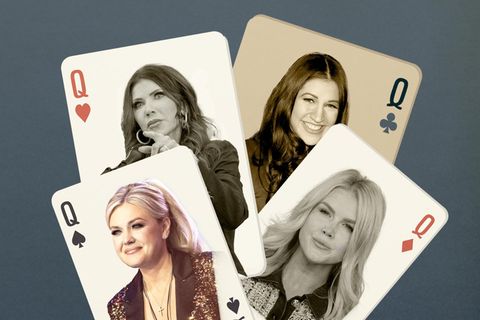Vor einiger Zeit saß ich in Glasgow in einen Sandwich-Laden, als zwei Schotten das Geschäft betraten und etwas bestellten. Was sie bestellten, konnte ich nicht verstehen. Dass sie Schotten waren, erkannte man an den Trikots der schottischen Rugby-Nationalmannschaft, die beide trugen. Sie unterhielten sich eine Zeitlang mit dem Mann hinterm Tresen in einer Sprache, die mir komplett fremd war. Und mit komplett meine ich: komplett. Ich verstand nicht mal Bahnhof. Ich hoffe bis heute, dass die drei gälisch miteinander sprachen. Das wäre eine Entschuldigung. Alles andere wäre mir peinlich. In einem Land zu leben und nicht mal Bahnhof zu verstehen, ist nicht schön.
„Das Englische ist eine einfache, aber schwere Sprache. Es besteht aus lauter Fremdwörtern, die falsch ausgesprochen werden”, notierte Kurt Tucholsky mal. Er hatte damals schon Recht. Es ist eine Mär zu glauben, Englisch sei leicht. Und das obschon, weite Teile des Englischen, zumindest des Altenglischen auf die Sachsen zurückgehen, der erste englische König Egbert hieß und die Sprache grob vom indo-europäischen Sprachbaum abstammt und dort dann noch mal vom germanischen Zweig, streng genommen der westlichen Astgabelung. „gægogæ mægæ medu“ ist der älteste überlieferte schriftliche englische Satz, graviert auf ein Goldmedaillon aus dem 5. Jahrhundert.
Er bedeutet so viel wie „Diese Wölfin ist eine Belohnung für meine Sippe“, sieht noch nicht so richtig englisch aus und klingt auch etwas unbeholfen. Bis Shakespeare war es da noch ein Weilchen, etwa elfhundert Jahre. Im Laufe der Jahrhunderte kamen dann immer Einflüsse dazu, Wikinger, Franzosen. Und schwupps schwoll der britische Wortschatz auf immense Größe. Das Oxford English Dictionary führt heute mehr als 600 000 Definitionen. Im Deutschen, auch durchaus Vokabel-reich, sind es zwischen 300 000 und 500 000 Wörter.
Nirgendwo gibt es so viele schöne Synonyme für Idiot
Briten haben zum Beispiel ein gutes Dutzend Verben für das ziemlich profane Verb werfen und damit mehr als die Innuit für Schnee, (erstaunlicherweise nur vier). Außerdem, das ist sehr schön und lässt obendrein tief blicken, benutzen sie eine grandiose Menge von Bezeichnungen für Idiot oder Trottel. Auch im Deutschen gibt es dafür viele Synonyme, sie hören sich aber nicht entfernt so herrlich an wie nincompoop, dope, dork, dunce, klutz, moron, oaf, numskull, nitwit, prat, twerp, twit, jerk oder wally. Meines Erachtens kann es in diesen verrückten Zeiten gar nicht genug davon geben. Das ausgesprochen hübsche Wörtchen doofer gehört leider nicht dazu, wie zu vermuten gewesen wäre; es bedeutet Zigarettenstummel.
Englisch ist also bei aller Simplizität doch ziemlich komplex und zuweilen zungenbrecherisch. Die für Ausländer am schwierigsten auszusprechenden Vokabeln sind nach einer weltweiten Umfrage unter Nicht-Briten Worcestershire (Wuss-ter-sheer), bekannt nach der gleichnamigen Sauce. Gefolgt von squirrel, brewery, regularly, phenomenon und February. Und selbst Briten geraten manchmal ins Straucheln. Der Schauspieler Benedict Cumberbatch sprach vor einigen Jahren für eine BBC-Naturdokumentation über Pinguine durchweg penguin wie peng-win aus. Das sollen nicht mal die Tiere besonders goutiert haben.
Darüber hinaus sind die Unterschiede zum Amerikanischen teilweise gravierend. „England and America are two nations separated by a common language“, England und Amerika sind zwei Nationen, die durch eine gemeinsame Sprache voneinander getrennt sind. Der Satz wird wahlweise George Bernard Shaw, Oscar Wilde und manchmal auch Winston Churchill zugeschrieben. Das zeigt schon, dass was dran sein muss. Und die amerikanische Autorin Mignon McLaughlin schrieb, jedes amerikanische Kind sollte mit einer zweiten Sprache aufwachsen, „am besten Englisch“.
Wer das richtig gut beherrscht, hat dann offenkundig auch noch Schlag beim anderen Geschlecht, denn Englisch ist ein echter Turn-On und führt die Liste der attraktivsten Akzente global an. Vor amerikanisch, irisch, australisch und französisch. Deutsch schaffte es erstaunlicherweise nicht in die Top Ten. Russisch, flämisch und dänisch aber auch nicht.
Aus eigener Erfahrung können wir bestätigen, dass britisches Englisch durchaus anziehend ist. Vor allem in Amerika. Die Frau ist Deutsche, aber englische Muttersprachlerin, aufgewachsen in London. Die Töchter sind auch Muttersprachlerinnen, aufgewachsen in den USA. Die Frau hat einen britischen Akzent, die Töchter einen amerikanischen, und ich habe irgendwas Undefinierbares. Wenn wir früher in einem Restaurant saßen und miteinander englisch sprachen, schauten die Leute am Nebentisch zuweilen erstaunt; sie müssen gedacht haben, ein europäisches Pärchen habe zwei amerikanische Mädchen entführt. Gelegentlich fragten wildfremde Menschen die Frau: „Sagen Sie doch bitte noch mal was. Es hört sich so klassisch an.“ Das tat sie dann und sagte irgendwas Unverdächtiges und bloß nichts Verwirrendes, was schneller passieren kann als man denkt. Pants beispielsweise bedeutet in den USA Hose und in Großbritannien Unterhose. Der simple Satz „I wish I had put my pants on“ kann also ganz unterschiedliche Konnotationen und bei Konversationen in, sagen wir, einem britischen Pub wenigstens Staunen und vermutlich auch neugierige Blicke generieren.
Obschon der Pub an sich beste der Ort für interkulturellen Austausch ist.
Schimpansen sind linguistisch erstaunlich weit vorne
Ein Freund, studiert in Schottland und Irland und des Englischen mehr als mächtig, hatte neulich beruflich im englischen Norden zu tun, betrat abends ein örtliches Etablissement und kam auf der Stelle ins Gespräch mit den Einheimischen. Wobei Gespräch nach seiner Erinnerung nicht ganz korrekt ist, denn es war eine eher einseitige Angelegenheit. Er verstand herzlich wenig und versuchte an Gestik und Mimik abzulesen, ob er nicken sollte oder lachen oder widersprechen oder am besten nur interessiert gucken. Erst mit erheblichem Alkoholkonsum und als er langsam tipsy, tiddly, boozed, plastered, squiffy, mullered, pickled, sloshed, sozzled, wellied und schließlich blotto, trolleyed und dann vollends stonkered war, schwand die Sprachbarriere, und die Verständigung klappte einigermaßen flüssig. Ähnliche Erfahrungen habe ich in Deutschland auch schon in Bayern oder Baden-Württemberg gemacht. Und womöglich funktioniert das in Schottland auch. Es kommt auf einen Versuch an.
Vor kurzem war zu lesen, dass Schimpansen, englisch: chimps, einen schottischen Akzent angenommen hatten, nachdem sie von einem niederländischen Safaripark in den Zoo von Edinburgh verlegt worden waren. Nach einer Weile grunzten die Affen erkennbar tiefer und irgendwie schottisch, wenn sie Äpfel oder Bananen wollten. Das stand in einer ernst zunehmenden wissenschaftlichen Fachzeitung. Chimps können sich also auf schottisch verständigen und sind mir damit linguistisch offenbar überlegen. Das hat mir abermals gezeigt, dass ich ein chump bin. Noch so ein hübsches englisches Wort für: Trottel.