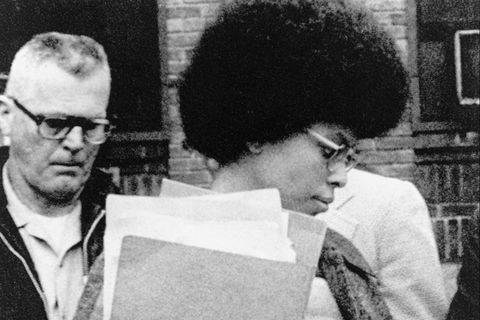Wenn Kubas acht Millionen Wahlberechtigte am kommenden Sonntag (19. Januar) zu den Urnen gerufen werden, dann gibt es für sie nicht viel zu wählen. Für die 609 Sitze im nationalen Volkskongress bewerben sich exakt 609 Kandidaten, unter ihnen Staats- und Parteichef Fidel Castro sowie sein jüngerer Bruder und Stellvertreter in allen Ämtern, Raúl. Wie einst im Ostblock sind allen Bewerbern Ergebnisse weit über 90 Prozent sicher. Das neu gewählte Parlament wird den 76-jährigen Castro dann aller Voraussicht nach für weitere fünf Jahre als Vorsitzenden des Staats- und Ministerrates bestätigen.
Ein Wahlkampf ist in der «sozialistischen Demokratie» nicht vorgesehen, doch haben Dissidenten die Gelegenheit genutzt, auf den undemokratischen Charakter der Wahlen hinzuweisen. In Kuba ist keine andere Partei als die kommunistische zugelassen, und die Aufstellung der Kandidaten wird von den Massenorganisationen kontrolliert. Die «Versammlung für eine Zivilgesellschaft», ein Zusammenschluss illegaler Oppositionsgrüppchen, rief Anfang Januar die Bevölkerung auf, ungültige oder unausgefüllte Stimmzettel abzugeben oder der Wahl ganz fernzubleiben. Die Regimekritiker wollen auch als Wahlbeobachter in die Stimmlokale gehen. Ob sie dies dürfen, ist ungewiss.
Schlechtestes Ergebnis unter Kubas Politgrößen: 93,6 Prozent
Die Kubaner haben zwar die Möglichkeit, einzelne Kandidaten abzulehnen, indem sie deren Namen auf dem Stimmzettel nicht ankreuzen. Bisher ist es aber noch nie passiert, dass ein Bewerber deshalb den Einzug ins Parlament verfehlt hätte. Denn nach Jahrzehnten totalitärer Herrschaft sind die Kubaner gewohnt, das zu tun, was die politische Führung von ihnen verlangt. So kam Fidel Castro bei den Parlamentswahlen im Januar 1998 in seinem Wahlkreis im Osten Kubas auf 99,3 Prozent der Stimmen, knapp hinter seinem Bruder Raul mit 99,9 Prozent. Das schlechteste Ergebnis unter Kubas Politgrößen erzielte damals Außenminister Roberto Robaina mit 93,6 Prozent. Robaina fiel bald darauf in Ungnade, wurde als Minister abgelöst und aus der Partei ausgeschlossen.
Hoffnungen auf politische oder wirtschaftliche Reformen blieben in den vergangenen fünf Jahren unerfüllt. Das so genannte Varela-Projekt, das eine Gruppe von Dissidenten im Mai vorigen Jahres zusammen mit 11 000 Unterschriften beim Volkskongress einreichte, wurde vom Parlament nicht einmal behandelt. Stattdessen ließ Castro - als Antwort auf eine Rede von US-Präsident George W. Bush - die sozialistische Staatsform als «unwiderruflich» in der Verfassung festschreiben. Wirtschaftlich hangelt sich das Land seit vielen Jahren am Rande der Pleite entlang. Die Zuckerindustrie steckt in ihrer schwersten Krise, und im Tourismussektor sind die Jahre zweistelliger Zuwachsraten vorbei.
Viele Kubaner fragen sich, ob Castro, dessen Gesundheitszustand in den vergangenen Jahren nicht mehr der beste schien, noch einmal eine Amtszeit von fünf Jahren durchhalten wird. In diesem Zusammenhang sorgte für Aufsehen, dass der eigentlich für Herbst 2002 anstehende VI. Parteitag der Kommunisten auf unbestimmte Zeit verschoben wurde. Kubaexperten wollen nicht ausschließen, dass Castro die Parteiführung an seinen 71-jährigen Bruder Raul abtritt. Die meisten seiner Kritiker aber glauben, dass nur die «biologische Lösung», der natürliche Tod des «Màximo Líder», den Weg für Reformen auf Kuba freimacht.
Kommunistische Herrschaft noch in vier Staaten
Innerhalb eines guten Jahrzehnts ist die in ihren Hochzeiten von vielen Staaten auf vier Kontinenten praktizierte kommunistische Herrschaft auf wenige Länder geschrumpft. Über zehn Jahre nach dem Zusammenbruch des Ostblocks mit der ehemaligen Sowjetunion als führender Macht herrschen heute nur noch in China, Vietnam, Kuba und Nordkorea kommunistische Parteien uneingeschränkt. Auch in diesen Ländern treten die inneren Widersprüche immer deutlicher zu Tage, an denen das vorherige kommunistische Imperium scheiterte.
Ende der 80er Jahre diktierten kommunistische Parteien mit ihrem Alleinvertretungsanspruch nach amerikanischen Untersuchungen noch in 15 Staaten das Geschehen. 25 weitere Länder wurden von marxistisch-leninistischen Regimen kontrolliert. Das Hoover-Institut gab in seinem Jahrbuch über den internationalen Kommunismus 1987 die Zahl der weltweit eingetragenen kommunistischen Parteimitglieder mit 89,8 Millionen an. Größte Partei war die KP Chinas mit 44 Millionen Mitgliedern, gefolgt von der KPdSU mit 18,5 Millionen.
Utopie einer klassenlosen Gesellschaft
Die vor rund 150 Jahren von Marx und Engels in ihrem Manifest entwickelte kommunistische Utopie von einer weltumspannenden klassenlosen Gesellschaft versuchte 1917 als erstes Land das revolutionäre Russland umzusetzen. Die diktatorische Sowjetunion drückte als Weltmacht dem vergangenen Jahrhundert 74 Jahre lang ihren Stempel auf.
Als Ergebnis des Zweiten Weltkrieges gerieten zunächst die Staaten Osteuropas und dann China unter kommunistische Regime. Außer in der UdSSR und China herrschten Kommunisten in unterschiedlichen Spielarten in Afghanistan, Albanien, Bulgarien, Kambodscha, Kuba, der Tschechoslowakei, in Ostdeutschland, Äthiopien, Ungarn, Laos, der Mongolei, in Polen, Rumänien, Vietnam, Nordkorea und Jugoslawien. Auch viele ehemalige Kolonien der Dritten Welt in Afrika, Asien und Amerika suchten weitgehend in Anlehnung an das sowjetische Modell ihr Heil im Kommunismus.