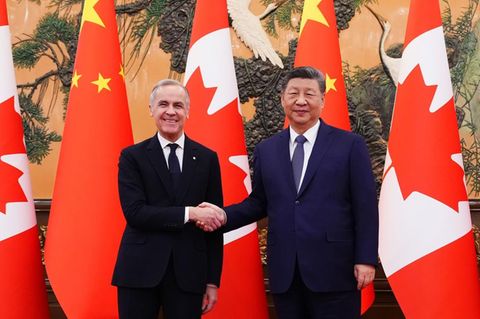Wohl von keinem anderen politischen Amt geht eine so große Faszination aus wie von dem des Präsidenten der Vereinigten Staaten. Zu Zeiten des Kalten Krieges galt er als der mächtigste Mann der westlichen Welt. Seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion 1991 nimmt er als Staatschef der einzig verbliebenen Supermacht eine noch herausgehobenere Stellung im globalen Machtgefüge ein.
"Schwerster Job der Welt"
Angesichts der nach dem Zweiten Weltkrieg gewachsenen außenpolitischen Verantwortung haben Sozialwissenschatfler das Amt des US-Präsidenten auch schon als den "schwersten Job der Welt" bezeichnet. Schließlich ist der Präsident kraft Verfassung von 1787 Staatsoberhaupt und Regierungschef in einer Person sowie Oberbefehlshaber der Streitkräfte.
Artikel II der Verfassung weist in sehr allgemeiner Form dem Präsidenten "die vollziehende Gewalt" zu. Dies lässt den jeweiligen Amtsinhabern großen Spielraum bei der Ausgestaltung des Amtes. Andererseits sind dem Präsidenten durch Kontrollrechte des Kongresses Grenzen gesetzt. Das aus Senat und Repräsentantenhaus bestehende Bundesparlament ist nach dem Verfassungsprinzip der Machtkontrolle und des Machtgleichgewichts (checks and balances) Gegenspieler des Präsidenten.
Bei der Gesetzgebung ist der Präsident auf die Zusammenarbeit mit dem Kongress angewiesen. Er hat das Recht, Gesetze vorzuschlagen und mit Hilfe von Parteifreunden einzubringen. Eine Mehrheit der eigenen Partei im Kongress ist aber noch längst keine Garantie dafür, dass er seine Gesetzesvorhaben auch durchbringt. So blieb die Gesundheitsreform von Präsident Bill Clinton in einem von seiner eigenen Demokratischen Partei beherrschten Parlament hängen, weil es ihm nicht gelang, konservative Parteifreunde von seinem Vorhaben einer einheitlichen Krankenversicherung für alle Amerikaner zu überzeugen.
Zuckerbrot und Peitsche
Vielfach kommt es auf das Geschick des Präsidenten im Umgang mit den Abgeordneten und Senatoren an, ob er eine Mehrheit für seine Gesetzesvorhaben im Kongress findet. Da bearbeitet ein Präsident vor wichtigen Abstimmungen schon einmal unschlüssige Parlamentarier am Telefon oder beim persönlichen Gespräch im Weißen Haus und bietet ihnen etwa im Gegenzug für ein positives Votum Finanzhilfen für bestimmte Projekte in deren Wahlkreis an. Der Präsident kann vom Kongress verabschiedete Gesetze mit einem Veto blockieren. Beide Häuser des Kongresses wiederum können das Veto mit Zweidrittelmehrheit überstimmen.
Im Krisen- und Kriegsfall verfügt der US-Präsident über erhebliche Vollmachten, die über seine militärischen Befugnisse hinausgehen und auch viele zivile Bereiche umfassen. Als Oberkommandierender der Streitkräfte kann er Soldaten bis zu 60 Tagen ohne Zustimmung des Parlaments zu Kampfeinsätzen entsenden. Von diesem Recht haben schon viele Präsidenten Gebrauch gemacht.
Amtsenthebungsverfahren gescheitert
Anders als die Regierungschefs vieler anderer Demokratien ist der amerikanische Präsident nicht dem Parlament verantwortlich und kann deshalb auch nicht von diesem abgewählt werden. Für den Fall des Amtsmissbrauchs oder krimineller Verfehlungen sieht die Verfassung eine Amtsenthebung (Impeachment) durch den Kongress vor. Im Zusammenhang mit der so genannten Lewinsky-Affäre musste sich George W. Bushs Vorgänger Clinton als zweiter Präsident in der US-Geschichte einem solchen Anklageverfahren stellen; Clinton wurde freigesprochen.
Auch das erste Amtsenthebungsverfahren gegen Präsident Andrew Johnson im Jahr 1868 endete mit einem Freispruch. Historiker sind sich darin einig, dass beide Impeachment-Verfahren politisch motiviert waren und nicht den Anforderungen entsprachen, die die Verfassung an eine Amtsanklage stellt. 1974 kam Präsident Richard Nixon einem Impeachment wegen der Watergate-Affäre mit seinem Rücktritt zuvor.
Höfischer Glanz im Weißen Haus
Amtssitz des US-Präsidenten ist seit 1800 das Weiße Haus in Washington. Als erster zog dort John Adams ein, der zweite Präsident der Vereinigten Staaten. Nicht zuletzt wegen des dort oft inszenierten pompösen Zeremoniells wird der Präsident auch von manchen als eine Art Ersatzmonarch der Amerikaner bezeichnet. Dies ist nicht einmal so abwegig: Die Verfassungsväter schufen das Präsidentenamt in Anlehnung an den englischen Monarchen des 18. Jahrhunderts. Zuletzt war es vor allem Ronald Reagan, der bei Staatsempfängen und anderen feierlichen Anlässen höfischen Glanz ins Weiße Haus brachte.