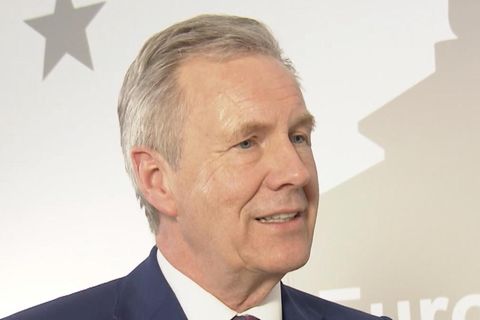Am frühen Donnerstagabend habe ich mit einer Bekannten telefoniert. "Übertreibt ihr's nicht?", fragte sie. "Ist's jetzt nicht langsam gut? Er hat sich doch entschuldigt." Sie hatte gelesen, dass ich Christian Wulffs TV-Auftritt für unsäglich halte und finde, dass er zurücktreten muss. Aus dem Hintergrund mischte sich der Mann der Bekannten in das Telefonat ein. "Der ist untragbar", sagte der. "Der macht allen etwas vor. Er muss weg." Das vorläufige Urteil des Volkes war zu diesem Zeitpunkt schon gefällt, eindeutig. Es gibt meiner Bekannten recht. Christian Wulff, so ergibt das Verdikt laut "Deutschland-Trend" der ARD mit großer Mehrheit (56 Prozent), soll Bundespräsident bleiben. Er hat eine zweite Chance verdient (60 Prozent der Befragten) - auch wenn sein Verhalten in Kredit- und AB-Affäre den meisten Befragten peinlich (57 Prozent) war und er als unglaubwürdig (56 Prozent) gilt.
Wie kann das sein? Wie kann es sein, dass die Bürger das höchste Staatsamt mehrheitlich weiter jemandem anvertrauen wollen, dem sie nicht glauben? Ist das nicht absurd? Schon, aber auch erklärbar. Wulff profitiert zum einen davon, dass von Politikern kaum noch etwas anderes erwartet, zum anderen davon, dass kritischen Medien pauschal misstraut wird. Die von klassischen Medien veröffentlichte Kritik an Wulff wird von vielen als Hetzjagd um der Hetzjagd willen abgetan. "Die wollen doch nur Schlagzeilen, Auflage, Klicks, Kohle!", heißt es. Aus dieser Perspektive hat Wulff mit seinem Angriff auf die "Bild"-Zeitung zwar über die Stränge geschlagen. Aber er hat einen verzeihbaren Fehler begangen. Nichts gilt hier das Argument, dass für einen Bundespräsidenten in mancher Hinsicht andere Verhaltensmaßstäbe gelten als für andere Menschen. Ein paar Prozentpunkte bei einem Kredit rausschinden für ein Häuschen in Niedersachsen? Mal austicken am Telefon? Ein bisschen spinnen, ein bisschen schummeln? Wer hat das nicht schon mal gemacht? Lasst doch die Kirche im Dorf!
Vom Täter zum Opfer der Medien
Das Ergebnis ist beachtlich. Binnen zwei Tagen verwandelt sich so der politische Missetäter Wulff in ein Opfer einer geifernden Medienkameradschaft, deren vermeintlich moralisch hochmütige Argumente als verlogen wahrgenommen werden. Dass die "Bild"-Zeitung, sonst Bannerträger des Emotionalen, diesmal Speerspitze der medialen Kritik ist, scheint die Heuchelei der gesamten Branche nur zu bestätigen. Dazu kommt, dass im allgemeinen medialen Getöse auch noch sämtliche ungeprüften Gerüchte, die im Netz kursieren und weiterverbreitet werden, den klassischen Medien zugeschrieben werden. Ihr seid doch unterste Schublade! Hört doch auf mit dem Gezeter! Habt ihr nichts anderes zu schreiben? Lasst Wulff in Ruhe! Basta. 60 Prozent für eine zweite Chance. Das ist eindeutig.
Sind wir Journalisten es also, die in Sack und Asche gehen müssen? Unsinn. Zunächst ist es ein Irrglaube, dass Medien allein jemals Politiker ins Amt gehievt oder sie daraus entfernt hätten. Ihr Job ist es, Politiker zu kontrollieren, Lesern Fakten zu liefern und diese einzuordnen, auch in Meinungsstücken. Was Wähler oder Politiker daraus machen, ist deren Sache - und war es auch schon immer. Sicher, auch wir müssen uns Glaubwürdigkeit erwerben, durch Recherche und die korrekte Beschreibung von Fakten, durch möglichst überzeugende Argumente und Deutungen. Und sicher, das gelingt uns auch mal schlechter und mal besser. Und Unsinn wäre es, hier zu behaupten wir wären 100 Prozent objektiv oder nicht manipulierbar. Geschenkt. Aber an dem Ziel, dass Medien dem Volk nicht nach dem Mund schreiben dürfen, sondern möglichst aufklärerisch arbeiten sollte, ändern weder Fehler etwas noch die Wulffsche Direktlegitimation.
Die Volksabsolution überstrahlt alles, oder?
Und dennoch verschiebt sich etwas in der Politik, wenn die Kontrollinstanz, wenn Medien in einer Demokratie bei vielen als unglaubwürdig gelten - und sich Politiker über Umfragen gleichsam gegen rationale Argumente direkt instant-rehabilitieren können. Für einen populistischen Politiker eröffnen sich neue Möglichkeiten. Wulff, der Politprofi, hat diese Möglichkeit in dieser Woche erkannt, geschickt genutzt und ist wirkungsvoll in die Lücke vorgestoßen. Bei seinem Fernsehauftritt hat er sich als fehlbarer Mensch inszeniert, als den netten Wulff von nebenan - und als Medienopfer. Das zog, das kam an beim Volk, wohl auch deshalb, weil es plausibel erscheint, dass der vermeintliche mediale Anspruch verfehlt ist, dass Politiker perfekt sein müssten. Dass Wulff aber selbst dann, wenn man von einem Politiker nur erwartet, dass er mit biografischen Brüchen oder persönlichen Fehlern offener, transparenter, nachvollziehbarer umgeht, durchfällt, ging nach der Generalabsolution unter. Dass sich nach dem Interview immer deutlicher zeigt, wie sehr Wulff bei seinen Behauptungen die Wahrheit verbogen hat, ist egal, zählt nicht mehr. Ähnlich war es übrigens bei Karl-Theodor zu Guttenberg. Auch der damalige Verteidigungsminister wäre 2011 fast damit durchgekommen, dass er das Volk auf seiner Seite hatte. Angela Merkel wagte nicht, ihn aus dem Amt zu kippen. Erst als klar war, dass neben den Medien noch zwei weitere Institutionen Guttenberg auf dem Kieker hatten, die Universität und die Justiz, war Schicht im Schacht. Das war dann doch zuviel.
Der Fall Wulff zeigt einmal mehr, dass sich die Bezugspunkte der Legitimation von Politikern ändern. Mussten Politiker früher ihr Verhalten vor allem gegenüber Normen rechtfertigen, die sich aus dem System oder dem Amt ergaben, die eher institutionell festgelegt waren und sich mit einem eng definierten bürgerlichen Anstandsethos mischten, sind sie zunehmend verführt, sich auf einen wie auch immer gearteten "gesunden Menschenverstand" zu stützen. Es ist schon viel darüber geschrieben worden, dass sich auch parlamentarische Systeme, in denen Parteien eigentlich die entscheidenden Akteure sind, immer stärker an charismatischen Personen orientieren. Die direkte Legitimation des Einzelnen wird immer wichtiger. Verbessern kann jeder Politiker seine Position zusätzlich, wenn er sich dem Volk als Bündnispartner gegen einen vermeintlichen, gemeinsamen inneren Gegner anbietet.
Die stille Merkel wird ihre Schlüsse ziehen
In den USA klappt das auf erschreckende Weise. In dem politisch tief gespaltenen Land haben fast alle demokratischen Institutionen plus Medien erheblich an Legitimität eingebüßt. Der politische Erfolg einzelner Politiker bemisst sich nicht an irgendwie vernünftigen Vorschlägen, sondern an deren Radikalität. Deutschland ist von so einer Entwicklung, Wulff hin oder her, zwar noch himmelweit entfernt. Ein gemeinsamer Diskurs ist noch möglich. Und Wulffs möglicher Verbleib im Amt wird genauso wenig eine Staatskrise auslösen wie es sein Rücktritt getan hätte. Aber auch hier sind die Sirenen des Populismus immer deutlicher hörbar. Nicht nur die stille Angela Merkel wird still ihre Schlüsse daraus ziehen, wenn sich Wulff mit Volkes Segen und populistischer Legitimation im Amt halten kann. Auch andere werden das tun. Horst Seehofer etwa, der CSU-Chef. Der ebnet, aus der Not der siechen CSU geboren, gerade schon den Weg für eine Rückkehr des Populisten Karl-Theodor zu Guttenberg. Es ist eine fast schon komische Vorstellung, dass Guttenberg schon 2013 von Bundespräsident Christian Wulff die Ernennungsurkunde zum Bundesminister ausgehändigt wird. Ich fände das, um Fragen vorzubeugen, nicht gut.