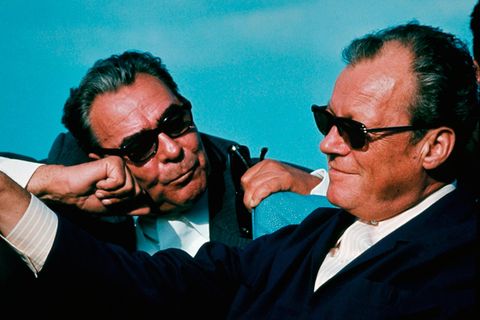Wörtlich genommen ist das Grundgesetz in Sachen Parlamentsauflösung und Neuwahlen eindeutig. Stellt der Kanzler die Vertrauensfrage und bekommt keine Mehrheit, kann der Bundespräsident das Parlament auflösen. Mit diesem Ziel haben das 1972 Willy Brandt und 1982 Helmut Kohl getan. Die aktuelle Frage lautet: Ist es mit dem Geist des Grundgesetzes vereinbar, auch wenn der Bundeskanzler rechnerisch an der Macht bleiben kann? Ziel der Verfassungsväter im Jahr 1948 war nach den Wirren der Weimarer Republik vor allem politische Stabilität. Die Abwahl eines Kanzlers sollte nach Paragraf 67 GG nur dann möglich sein, wenn gleichzeitig mit dem "konstruktiven Misstrauensvotum" ein Nachfolger bestimmt wird.
Kein Recht auf Selbstauflösung
Die in Paragraf 68 GG angesprochene Vertrauensfrage wurde nach übereinstimmender Meinung der Historiker vom Parlamentarischen Rat vor allem als Disziplinierungsinstrument verstanden: Mit der Drohung des Machtverlustes sollte der Kanzler sein Lager in die Pflicht nehmen und die eigene Position stärken können. Ein Recht des Bundestages auf Selbstauflösung sieht das Grundgesetz im Gegensatz zur Weimarer Verfassung nicht vor.
Es dauerte allerdings bis zum 20. September 1972, ehe im Bund die Vertrauensfrage mit dem Ziel der Neuwahlen gestellt wurde. Willy Brandt, der Kanzler der Ostpolitik, hatte zwar im April das konstruktive Misstrauensvotum seines Rivalen Rainer Barzel (CDU) knapp überstanden, verfügte im Parlament aber nicht mehr über die Kanzlermehrheit. Mit 248 zu 248 Stimmen war ein Patt im Bundestag entstanden: Weder Brandt noch Barzel hätten auf Dauer regieren können.
Weil Brandt die Vertrauensfrage mit dem Ziel, sie zu verlieren, stellen konnte, ohne dabei schummeln zu müssen, war der damalige Bundespräsident Gustav Heinemann ohne Bauchschmerzen in der Lage, den Bundestag aufzulösen. Dass Brandt damals seine Ministerriege dazu verdonnerte, sich der Stimme zu enthalten und ihm damit das Vertrauen zu entziehen, hatte keine verfahrensrechtliche Bedeutung, sondern allenfalls eine disziplinarisch-politische: Auf diese Weise ersparte der Kanzler den fest hinter ihm stehenden sozialliberalen Abgeordneten Loyalitätskonflikte.
Sieg mit Glanz und Gloria
Vorübergehende Schwierigkeiten bereiteten der amtierenden Koalition nur der Zeitpunkt und die gesetzlichen Fristen, die aber dermaßen geschickt gehandhabt wurden, dass SPD und FDP im November 1972 mit Glanz und Gloria wiedergewählt wurden. Brandt war es im Einklang mit den Buchstaben des Paragrafen 68 GG gelungen, den Wahltag und den Höhepunkt seiner Popularität miteinander zu verbinden und die Bürger mehrheitlich für sich zu gewinnen.
Rund zehn Jahre später war es Helmut Kohl, der mit Hilfe der Vertrauensfrage demokratische Legitimation erreichen wollte und auch erlangte. Der Unterschied: Weil die FDP von der SPD zur Union übergelaufen war, musste Kohl sein Lager zur Enthaltung verpflichten, damit er die Vertrauensfrage wenigstens auf dem Papier verlor. Freilich hatte Kohl gute, später auch von Bundespräsident Karl Carstens anerkannte politische Gründe für sein Vorgehen: Zwar hatte er das Misstrauensvotum gegen SPD-Kanzler Helmut Schmidt gewonnen, doch konnte und wollte Kohl nicht mit der FDP regieren, ohne durch Wahlen legitimiert zu sein.
Bundeskanzler Gerhard Schröder wird am 1. Juli mitteilen, mit welcher Begründung er die Vertrauensfrage stellen und wie er sie legitimieren wird. Schröder hatte im Jahr 2001 schon einmal im Bundestag die Vertrauensfrage gestellt. Der Bundestag sprach dem Regierungschef mit knapper Mehrheit das Vertrauen aus und machte gleichzeitig den Weg für den Einsatz von 3.900 deutschen Soldaten im "Anti-Terror-Kampf" frei. Die beiden von Schröder verknüpften Anträge erhielten 336 Stimmen und damit nur zwei mehr als die erforderliche Kanzlermehrheit. In der Debatte hatte Schröder die Verknüpfung von Vertrauens- und Sachfrage damit verteidigt, dass es um die Verlässlichkeit deutscher Politik gehe. Für eine Entscheidung von solcher Tragweite sei es unabdingbar, dass sich Kanzler und Regierung auf eine Mehrheit der eigenen Koalition stützen könnten. Er habe kein Verständnis für diejenigen, die von einer Einschränkung der Gewissensfreiheit der Abgeordneten sprächen.
Rücktritt wäre der einfachste Weg
Freilich hätten Brandt 1972, Kohl 1982 und Schröder 2005 theoretisch einen zweiten, viel einfacheren Weg zu Neuwahlen einschlagen können: ihren Rücktritt.