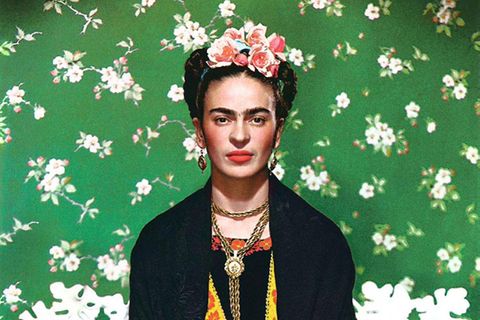Zwei der drei Männer auf dem Podium des olympischen 200-Meter-Laufs 1968 recken am Abend des 16. Oktober ihre Fäuste in schwarzen Handschuhen in die Luft, sie haben den Kopf gesenkt und tragen zu den Handschuhen auch noch schwarze Socken, keine Schuhe.
Weltweite politische Unruhen überschatten die Spiele
Kein Fotoband über die sechziger Jahre kommt ohne dieses Foto aus und es entfachte in den USA, wenige Wochen nach den Morden an Bobby Kennedy und Martin Luther King einen Sturm öffentlichen Interesses - zwei Athleten in Trainingsanzügen mit der Aufschrift "USA", die vor aller Welt ihre Solidarität mit der um Gleichberechtigung kämpfenden farbigen US-Bevölkerung demonstrierten.
Ohnehin standen die Spiele wie noch nie seit dem zweiten Weltkrieg mitten in der politischen Auseinandersetzung der Zeit. 1968 waren die Truppen des Warschauer Paktes in der Tschechoslowakei einmarschiert und damit den "Prager Frühling" beendet und weltweit gab es spektakuläre Studentenunruhen und Proteste gegen den Krieg in Vietnam.
Kurz vor Beginn der Spiele eskalierten auch in Mexiko die Proteste von Studenten gegen die Dauer-Regierungspartei PRI, die de facto ein diktatorisches Regime führte. Viele Wochen wurde die größte Hochschule Lateinamerikas, die Autonome Universität Mexiko-City, durch Streiks lahm gelegt. Die Studenten spekulierten auf Zugeständnisse der Regierung, die bei den Olympischen Spielen Ruhe im Land haben wollte, aber mit welcher Brutalität und Skrupellosigkeit diese erreicht wurde, hatten die Protestierenden nicht erwartet.
Das Massaker von Tlatelolco
Am Abend des 2. Oktober 1968, zehn Tage vor der offiziellen Eröffnung der Spiele, demonstrierten Tausende von Studenten auf dem Platz der drei Kulturen in Tlatelolco, einem Vorort von Mexiko City. Sie ahnten nicht, dass sie in eine Falle der Sicherheitskräfte liefen, denn rund um den Platz waren Maschinengewehre postiert. Wie der genaue Ablauf der dann folgenden Geschehnisse war, ist nie zweifelsfrei geklärt worden, fest steht, dass mit automatischen Waffen wahllos in die Menge gefeuert wurde und Panzer die Fluchtwege abriegelten. Nach der Zählung von Menschenrechtsorganisationen wurden an diesem Abend 337 Menschen getötet, über Tausend verletzt und Hunderte verhaftet. Hinter vorgehaltener Hand kursierten sogar weit höhere Zahlen, aber da die Regierung die Toten schnell verschwinden ließ, war es unmöglich, Beweise dafür zu erbringen.
Der Jahrhundertsprung
Nur zehn Tage nach dem Massaker eröffnete Mexikos Präsident Gustavo Díaz die Spiele, es gab keinen Protest durch das IOC, niemand boykottierte die Spiele oder blieb der Eröffnungsfeier fern - die Weltöffentlichkeit zog es vor, sich in Mexiko ausschließlich mit Sport zu beschäftigen.
Zwischendurch stand dann auch der Sport im Vordergrund und sensationell war vor allem eine Leistung: Es war genau 15.46 Uhr Ortszeit an dem regnerischen Nachmittag des 18. Oktober 1968, als in der Höhenluft von Mexico City der wohl bedeutendste Weltrekord aller Zeiten aufgestellt wurde.
Der 22-Jährige US-Amerikaner Bob Beamon nahm einen kraftvollen, dennoch leichtfüßigen Anlauf, sprang ab und flog so weit wie nie ein Mensch zuvor. Der Rückenwind von zwei Metern pro Sekunde war eben noch zulässig. Als die Kampfrichter mit der neuen optischen Weitenmessung den Aufsprung fixieren wollten, schauten sie sich nur noch ratlos an - die Anlage war für diese Weite nicht ausgeliegt.
Ein Rekord für 23 Jahre
Hektisch organisierten die Kampfrichter ein Maßband, der Legende nach stand der vorherige Weltekordlker Igor Ter-Owanesjan (UDSSR) am Rand der Grube und sagte: "Nach diesem Sprung sehen wir alle aus wie Kinder." Nach langer Verzögerung kam das offizielle Ergebnis, Bob Beamon war 8,90 Meter weit gesprungen, ein Fabelweltrekord, den erst mit Mike Powell 1991 verbessern konnte und der seither auch nicht wieder übertroffen wurde.
1968 brachte im über 2200 Meter hoch liegenden Mexico City eine Flut von weiteren Rekorden in der Leichtathletik, aber keiner wirkte nur annähernd so lange nach wie Beamons Sprung. Die neu entwickelte Tartanbahn und die Höhenluft spielten dabei eine große Rolle, aber auch die Anwendung der noch nicht nachweisbaren Anabolika wirkte vermutlich an den Leistungsexplosionen bei diesen Olympischen Spielen mit.
„Silent Gesture“ für Bürgerrechte
Bereits zwei Tage vor Beamons Jahrhundertsprung war es zu einem historischen Eklat gekommen: Die beiden farbigen Amerikaner Tommie Smith, Gewinner der Goldmedaille, und John Carlos, der Drittplatzierte, wurden nach dem olympischen 200-Meter-Lauf zur Siegerehrung gebeten. Auf dem Podium setzten sie ein Zeichen, das zum Meilenstein für die amerikanische Bürgerrechtsbewegung wurde, sie hielten bei der Siegerehrung den Kopf gesenkt und streckten die Faust in einem schwarzen Handschuh hoch, das Zeichen der radikalen Black-Power-Bewegung.
Smith und Carlos kamen beide von der San Jose State University in Texas und standen unter dem Einfluss des Bürgerrechtlers Harry Edwards, dessen Bewegung versucht hatte, farbige Sportler zum Olympiaverzicht aufgrund der Bürgerrechtssituation in den USA zu bewegen.
Das Spießrutenlaufen begann für Smith und Carlos nach ihrem Rausschmiss erst richtig, der Olympiasieger flog nicht nur aus dem Nationalkader, sondern ihm wurden auch alle Fördergelder gestrichen. Mit 24 Jahren war seine Karriere praktisch beendet und Smith wurde arbeitslos, fand erst nach längerer Zeit einen Job als Trainer. Gegen beide Sportler und ihre Familien gab es ernst zu nehmende Morddrohungen weißer Rassisten, aber auch unter aufgeklärten Amerikanern wurde die Aktion kontrovers diskutiert. Der Olympiasieger räumte später mit vielen Mythen auf, die sich um ihren Auftritt rankten, so war er kein Mitglied der radikalen "Black Panthers" und seine Goldmedaille wurde auch nicht vom IOC aberkannt, wie es immer wieder in Medienberichten hieß.
Ein Vorbild für Peking?
Smith und Carlos zerstritten sich später hoffnungslos und verbreiten auch vierzig Jahre später noch verschiedene Versionen des Geschehens, in denen sie jeweils selber die Heldenrolle einnehmen. Im Hof ihrer alten Universität in San Jose erinnert ein zehn Meter hohes Denkmal an die beiden Olympioniken und ihren gewaltfreien Protest im Geiste von Dr. Martin Luther King.
Das Thema "protestierende Sportler" ist vor den Spielen in Peking wieder von frappierender Aktualität, kämen doch Proteste vom olympischen Siegerpodest aus auch bei diesen Spielen alles andere als überraschend. Die Menschenrechtssituation in China und insbesondere die militärischen Aktionen gegen die protestierenden Menschen in Tibet könnten viele politisch bewusste Sportler zu ähnlichen Aktionen veranlassen. Dazu gehört Mut, und Smith und Carlos haben persönlich teuer bezahlt. Mit der Aktion gelang ihnen allerdings etwas, was nur wenigen vergönnt ist, sie setzten ein Zeichen, das zu den prägendsten Eindrücken einer Generation und einer Ära gehört.