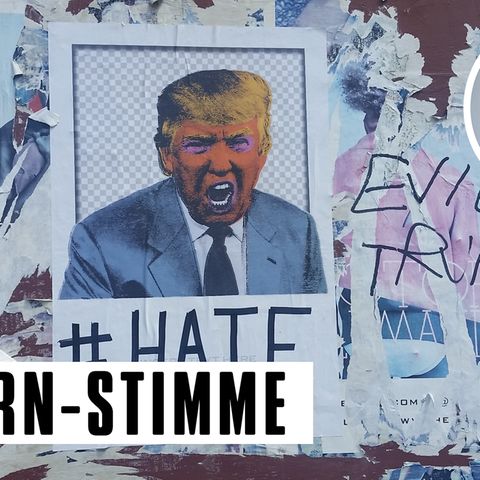Wir haben es nun schwarz auf weiß, die deutsche Wirtschaft schrumpft. Zwar nur um 0,1 Prozent und nur in einem Quartal, aber die Wahrscheinlichkeit einer Rezession steigt damit weiter. Entscheidend ist aber nicht nur der Rückblick auf das zweite Quartal, sondern der Ausblick auf die nächsten Quartale, der ebenfalls düster ist. Die Auftragsbücher mögen oft noch gut gefüllt sein, aber die Stimmung ist gedämpft.
Es ist das Kraftzentrum des Landes, das große Teile des Aufschwungs der vergangenen Jahre getragen hat, das schwächelt: die Industrie, der Maschinenbau, die Autobauer. Wir hören fast täglich Meldungen über Umsatzeinbrüche und Gewinnwarnungen, so wie wir früher die Rekorde hörten. Nach dem Boom-Stakkato nun das Doom-Stakkato. Allein der Konsum, der über Jahre das Sorgenkind war, ist ungebrochen stark.
Der Weckruf ist zu einsam
Zwei Phänomene lassen sich dieser Tage beobachten, das eine ist beunruhigend, das andere überraschend. Beunruhigend ist die nach wie vor zu große Gelassenheit der Regierung. "Ich sehe derzeit keine Notwendigkeit für ein Konjunkturpaket", hat Angela Merkel gesagt. Ähnliche Töne hören wir vom Finanzminister. Eine Regierungssprecherin bekräftigte diese Woche, man sehe "aktuell keine Notwendigkeit für weitere Maßnahmen zur Stabilisierung der Konjunktur". Allein Wirtschaftsminister Peter Altmaier spricht von einem "Weckruf und Warnsignal" und will gegensteuern – ihm fehlen die Verbündeten. Die Abschaffung des Soli ab 2021, die manche pflichtschuldig nennen, ist keine akute Maßnahme, das wäre zu spät.
Überraschend hingegen ist, dass der Ruf nach Investitionen und einer höheren Verschuldung aus ganz verschiedenen Lagern kommt, nicht nur aus der linken Straßen-Schulen-Brücken-Fraktion, die ihre Forderungen nach Milliardenpaketen besser im Kanon singen als die Regensburger Domspatzen. Nein, die Stimmen kommen von den Arbeitgebern selbst: "Es liegen trübe Monate vor uns, die drohen zu Jahren zu werden – wenn die Politik nicht kräftig gegensteuert" mahnte etwa Joachim Lang, Hauptgeschäftsführer des BDI. Michael Hüther, Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, hat diese Woche einen Deutschlandfonds gefordert, 450 Milliarden Euro schwer. Nicht als kurzfristigen Stimulus, sondern um langfristig genug zu investieren.
Schulden sind keine Frage der Moral, sondern der Mathematik
Hier erleben wir eine interessante weitere Verschiebung der Debatte: den Streit um das Ende der "schwarzen Null". Vom Finanzminister und der Kanzlerin wird sie noch rhetorisch verteidigt, aber ihr Schicksal scheint besiegelt.
Es ist nämlich eine nüchterne Rechnung, die Ökonomen aus beiden Lagern aufmachen: Ein Staat, der sich umsonst Geld leihen kann oder dafür sogar bezahlt wird (die Renditen aller Bundesanleihen waren Anfang August negativ) wäre töricht, diesen Spielraum auf Dauer auszuschließen. Zumal er sich auch Geld für 30 Jahre zinslos leihen kann und seine Gesamtverschuldung dank des kräftigen Wachstums von über 80 auf 60 Prozent des BIP gefallen ist. Wir haben eine Situation, sagt Hüther, in der der Realzins niedriger ist als die Wachstumsrate und erst Mal bleiben wird. Künftige Zinslasten für die Nachfolgegenerationen sind also leichter zu schultern. Deutschland kann sich mit etwa 50 Milliarden Euro pro Jahr Verschulden und trotzdem die Maastricht-Kriterien einhalten. (Es gibt auch Stimmen, die das kritisch sehen – mehr dazu lesen Sie hier.)
Schulden waren über Jahre in Deutschland eine Frage der Moral, wenn man zu viel ausgab als einnahm, war man "Schuldensünder". Dann schon lieber schwäbische Hausfrau. Über den ökonomischen Sinn dieses Satzes wurde lange gestritten. Inzwischen ist er hinfällig. Schulden, das zeigt sich heute, sind keine Frage der Moral, sondern der Mathematik. (Pragmatische Stimmen mögen einwenden, dass die schon vorher galt. Richtig, aber dies war in Deutschland nicht mehrheitsfähig. Die Mathematik ist heute noch bestechender.)
Auf dem Weg zur Klimaabgabe und dem Ökosoli
Wenn Deutschland als "sicherer Hafen" sich über Jahrzehnte zinslos verschulden kann, kann man das als weiteres Symptom für eine Krise deuten. Als Verzerrung in einem Finanzsystem, dass nach vielen Jahren des billigen Geldes aus den Fugen ist. Aber auch hier sollten wir nüchtern sein: Es ist unwahrscheinlich, dass die Zinsen so schnell steigen werden. Das Geld wird über Jahre hinaus eher billig bleiben, und Deutschland sollte diesen Spielraum nutzen – nicht aber, weil man es kann, sondern weil man es muss: Die Gefahr weiterer Schocks ist einfach zu groß.
Natürlich steht zu befürchten, dass man mit frischen Milliarden irgendwelche Luftschlösser baut oder Geschenke verteilt. Das wird die größte Herausforderung: Viel Geld sinnvoll zu investieren – und nicht stumpf zu verteilen. Denn auch wenn man keine Zinsen zahlen muss: Zurückzahlen muss der Staat es ja dennoch. Versenktes Geld, sei es in Flughäfen, die nicht öffnen oder Straßen, die keiner braucht, bleibt genauso schädlich.
Ich habe den Eindruck, dass die Sache in Berlin längst ausgemacht ist. Während man bei der kurzfristigen Stützung der Konjunktur zu zögerlich ist, soll langfristig mehr Geld ausgegeben werden. Man braucht dafür noch nicht mal die Schuldenbremse auszuhebeln. So wie man früher Nebenhaushalte und Sondervermögen erfand, wird man das frische Geld in Sonderfonds packen. Und damit niemand dagegen ist, wird man diese Fonds grün anstreichen, und "Klimafonds" nennen. Das gilt übrigens auch für Steuern, ich erwarte keine Reichensteuer oder Vermögensabgabe mehr. Man wird es "Klimaabgabe" nennen. Oder "Ökosoli". Wer kann da schon nein sagen?
Es gibt also auch Risiken in der Welt der leichten Schulden. Wir sollten also auch bei mathematisch bestechenden Plänen nicht den Verstand verlieren.