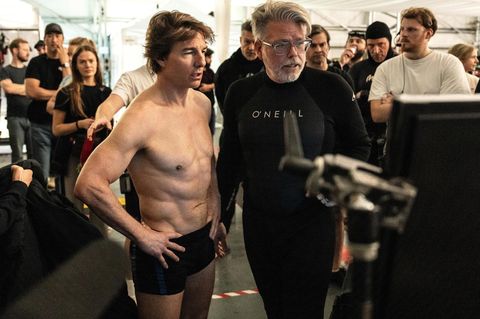Die Diskussion wird in den USA schon seit fast drei Jahren geführt, und selbst die bankenfreundlichen Briten wollen den Schnitt wagen: die Trennung des Geschäftskunden- vom Investmentsektor der Banken. Trennbankensystem nennt sich das Prinzip, das nun auch Sigmar Gabriel einfordert und dafür sogar Applaus von Teilen der Regierung bekommt. In einem Interview sagte der SPD-Chef: "Jeder Mittelständler, der einen Kredit braucht, wird morgen in Schwierigkeiten kommen, wenn eine Bank pleitezugehen droht, weil sie sich im Investmentbanking verzockt hat." Das Finanzministerium antwortete wohlgesonnen: "Darüber sollte auf internationaler Ebene intensiv diskutiert werden."
Natürlich regt sich auch Widerstand gegen die Idee: FDP-Fraktionsvize Florian Toncar wirft Gabriel vor, "den Demonstranten auf der Straße" hinterherzurennen, und der CDU-Finanzexperte Klaus-Peter Flosbach sagte: "Wir brauchen keine Holzhammervorschläge, sondern bessere Regulierung."
In Deutschland und auch in der Schweiz gilt seit jeher das Universalbankenprinzip, sprich: Sämtliche Geschäftsbereiche eines Geldinstituts sind in einem Unternehmen gebündelt. Länder wie die USA und Großbritannien dagegen hatten jahrzehntelang gute Erfahrungen mit dem nun wieder in Mode gekommenen Trennbankenprinzip gemacht.
Glaubenskrieg um Bankensysteme
Über diese Systemfrage herrscht unter Ökonomen schon länger eine Art Glaubenskrieg. Die Trennung hat einige Vorteile:
- Ein Argument lautet, dass etwa Spareinlagen normaler Schalterkunden für die Finanzierung von riskanten Investmentgeschäften benutzt werden. Problem dabei: Gehen die Investitionen schief, können die Verluste nicht nur den Wertpapierbereich gefährden, sondern gleich die ganze Bank mit. Geraten die Spareinlagen in Gefahr, müsste im schlechtesten Fall der Steuerzahler für Ausfälle aufkommen, da der Staat für die Guthaben bürgt.
- Außerdem, so die weitere Kritik am Universalprinzip, befänden sich die Banken in einem ständigen Interessenkonflikt. Gibt zum Beispiel die Investmentabteilung Aktien im Auftrag eines Unternehmens heraus, könnte sie ihren Anlegern genau diese Aktien verkaufen wollen - unabhängig davon, ob es sich dabei um eine vielversprechende Investition handelt oder nur die Bank profitiert. Auch Unternehmen, die bei einem Institut Kredite aufgenommen haben, könnten durch die Bank genötigt werden, an die Börse zu gehen - was wiederum für den Investmentbereich lukrativ ist.
- Zudem wird oft argumentiert, dass es getrennten Banken nicht einfach möglich ist, faule Kredite in faule Wertpapiere umzuwandeln - so wie es während der Immobilienblase in den USA der Fall war, durch die 2008 die Weltwirtschaft ins Wanken geraten war.
Nicht allzuviele Hoffnung in die Trennung setzen
Theoretisch spricht also einiges für die Trennung des Kunden- vom Wertpapiergeschäfts. Praktisch allerdings wurde und wird die strikte Aufsplittung über Umwege immer wieder umgangen: Die USA etwa hatten nach der Wirtschaftskrise in den 20er Jahren das Trennbankensystem eingeführt, das in den folgenden Jahrzehnten allerdings immer weiter aufgeweicht und 1999 letztlich abgeschafft wurde. Denn die Wirklichkeit der sich globalisierenden Wirtschaft hatte die Theorie längst überholt: Die Banken gründeten in unregulierten Ländern kurzerhand Investmenttöchter und hebelten so die Trennung aus. "Außerdem könnten Banken etwa über neue Konstruktionen weiterhin in beiden Geschäftsbereichen tätig sein", sagt Thomas Straubhaar, Chef des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und stern.de-Kolumnist. Deshalb solle man nicht zu hohe Hoffnungen in die Aufsplittung von Geschäfts- und Investmentbanking setzen.
Nichtsdestotrotz fordern US-Experten die Wiedereinführung des Trennbankensystems. Darunter auch Paul Volcker, ehemaliger Chef der US-Notenbank und Ex-Berater von Präsident Barack Obama. Geldinstitute sollen nach seiner Vorstellung zwar weiterhin Teile des Investmentbankings im Auftrag ihrer Kunden fortführen dürfen, ohne aber sich in hochspekulative Geschäfte zu verdingen. Auch die Beteiligung oder Zusammenarbeit mit Hedgefonds soll verboten werden. Ähnlich sieht es auch der Deutsche Sparkassen und Giroverband: "Nach unserer Meinung ist es sinnvoll, den Eigenhandel möglichst weit vom Kundengeschäft zu trennen", so ein Verbandssprecher in der "Welt".
Wertpapierhandel macht über die Hälfte des Gewinns aus
In Deutschland wäre vor allem die Deutsche Bank von diesem Plan betroffen. Denn sie verfügt als einziges Institut hierzulande über einen nennenswerten Investmentbanking-Anteil: Rund elf Milliarden Euro soll die Bank nach dem Willen von Vorstandssprecher Josef Ackermann in diesem Jahr erzielen, 6,3 Milliarden Euro davon soll der Wertpapierhandel beisteuern, das klassische Kundengeschäft 1,6 Milliarden. Sollte sich die Trennbankenbefürworter durchsetzen, würde das für die Deutsche Bank einer Zwangsschrumpfkur gleichkommen. Das allerdings hieße auch: Gerät sie durch Konjunktureinbrüche oder die deutlich mächtigere internationale Konkurrenz in Schieflage, wäre sie dann doch wieder auf die Hilfe der Steuergelder angewiesen. Ökonom Straubhaar glaubt daher, dass das Trennbankensystem, wenn überhaupt, nur eine von vielen Maßnahmen sein könne, zudem müssten globale Finanzakteure auch global reguliert werden. "Das aber kann dauern - zehn Jahre werden sicher vergehen, bis weltweit einheitliche Regeln durchgesetzt werden und greifen."