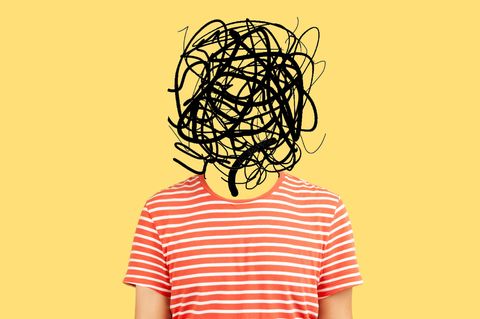Die Wahl des früheren Handelskommissars der Europäischen Union, Pascal Lamy, zum neuen Chef der Welthandelsorganisation (WTO) an diesem Donnerstag gilt als sicher. Noch wurde er nicht offiziell ernannt, doch seit Carlos Pérez del Castillo aus Uruguay seine Bewerbung zurückgezogen hat, ist Lamy der einzige Kandidat. Er gilt als gewählt, wenn niemand gegen ihn stimmt. Damit übernimmt der französiche Diplomat die Brücke der WTO in schwerer See: Die Welthandelsrunde kommt derzeit nur schwerfällig bei der Umsetzung ihrer Ziele von Doha voran. Dort wurde 2001 vereinbart, den Markt der Europäischen Union stärker für Dienstleister und Industriegüter aus Entwicklungsländern zu öffnen. Dafür sollten sich diese im Gegenzug mehr für Umweltschutz, Rechtsstaatlichkeit und Wettbewerb verpflichten.
Die Welthandelsorganisation (WTO)
Die WTO (englisch für World Trade Organization) ist eine internationale Organisation mit Sitz in Genf, die sich mit der Regelung von Handels- und Wirtschaftsbeziehungen beschäftigt. Die WTO hat 148 Mitglieder, unter anderem die EU und alle EU-Mitgliedsstaaten. Ziel der WTO ist der Abbau von Handelshemmnissen. Den Kern dieser Anstrengungen bilden die WTO-Verträge (z.B. GATT), die durch die wichtigsten Handelsnationen ausgearbeitet und unterzeichnet wurden.
Doch die WTO sei "schwerfällig und nicht reformierbar", klagte Lamy noch im Jahr 2003. Damals war er noch EU-Handelskommissar und kaute schwer am Scheitern des WTO-Gipfels im mexikanischen Cancún, der am Streit zwischen armen und reichen Ländern geplatzt war. Die laut Lamy "mittelalterliche Organisation" zwingt ihre 148 Mitgliedsstaaten zum gemeinsamen Handeln, die Mitglieder entscheiden im Konsens, jedes Land kann per Veto alles verhindern. Der WTO-Generaldirektor hat weniger Macht als seine Kollegen von Weltbank und Internationalem Währungsfonds. Er kann kein Geld verteilen, hat keine Vollmachten, er nimmt eher die Rolle des Moderators ein. Aber mit dem nötigen Geschick kann der neue Generaldirektor Themen und Termine setzen.
Französische Bilderbuchkarriere
Und für diesen Job ist Pascal Lamy wie geschaffen: Er ist Absolvent dreier französichen Eliteinstitute: der Handelsakademie EHEC, dem Institut für Politkwissenschaften "Sciences Po" und der Verwaltungshochschule ENA. Früh stieß er in seiner politischen Laufbahn auf seinen Mentor Jacques Delors. In dessen Führungsstab im Pariser Finanzministerium lernte er die Finessen der Handelspolitik, den Expertenjargon - und das Wesen des Basargefeilsches. Als Delors 1985 EU-Kommissionspräsident wurde, folgte ihm Lamy als Chef seines Brüsseler Kabinetts. Nach einem Ausflug in die Privatwirtschaft - 1994 wechselte er zur maroden französischen Großbank Crédit Lyonnais - kehrte er 1999 auf die Brüsseler Politbühne zurück, diesmal als EU-Handelskommissar.
Die Doha-Runde
Als Doha-Runde oder auch Doha Entwicklungsagenda wird ein Paket von Aufträgen bezeichnet, welches die Wirtschafts- und Handelsminister der WTO-Mitgliedsstaaten 2001 auf ihrer vierten Konferenz in Doha bearbeiten und bis 2005 abschließen sollten. Zu einem Verhandlungsabschluss kam es aber aufgrund unterschiedlicher Ansichten der WTO-Mitglieder bisher nicht. Nachdem die Ministerkonferenz in Cancún 2003 keine Annäherung brachte, wurden die Verhandlungen unterbrochen, im Juli 2004 jedoch wieder aufgenommen.
Der spröde Asket und Marathonläufer will eine "Globalisierung mit menschlichem Antlitz". Doch es ginge auch nicht an, so Lamy, dass ärmere Länder viel fordern, ohne etwas dafür anzubieten. In den elf Jahren seit Gründung der WTO wurde das eigentliche Ziel - dass die Mitgliedsstaaten ihre Märkte öffenen und alle Handelshemmnisse beseitigen - noch immer nicht in einem Abkommen festgehalten. Die Gipfel in Seattle 1999 und in Cancún 2003 blieben denn auch eher durch die Aktionen der Globalisierungsgegner in Erinnerung, als durch wesentliche Fortschritte in der Liberalisierung des Welthandels. Dies soll endlich auf dem nächsten Gipfel im Dezember in Hongkong passieren. Bis Ende 2006 soll dann ein Freihandelsabkommen unterschriftsreif verhandelt sein. Und die Zeit drängt: Gelangt die Ministerrunde in Hongkong wieder zu keinem Ergebnis, könnten es für die ärmeren Länder böse enden - sie würden endgültig auf die Verliererseite rutschen.
Horrorszenario Zoll-Anarchie
Die reichen Länder würden ohne Rahmenabkommen ihre eigenen Regeln im Handelsverkehr diktieren und untereinander Abkommen schließen. Besonders die USA setzen zunehmend auf bilaterale Verträge, die in den letzten Jahren auch weltweit stark zugenommen haben. Von diesen Regelwerken profitieren aber nur die beteiligten Länder - Zölle und Regeln würden wieder uneinheitlich und unübersichtlich. Lamys Wahl kann durchaus als Signal an die Schwellen- und Entwicklungsländer verstanden werden, dass ihnen EU, Japan und die USA bei den kommenden Verhandlungen entgegenkommen wollen.
Dafür verlangen die mächtigen Exportnationen die Einigung auf einen Kompromiss: Demnach sollen die Schutzzölle nicht mehr auf das Gewicht, sondern auf den Wert einer Ware erhoben werden. WTO und Vereinte Nationen würden den Preis eines Agrarproduktes festlegen, aus dem dann ein Wertzoll errechnet wird. Über die Formeln dazu soll ab 30. Mai verhandelt werden. Die nötige Entschlossenheit, diese Verhandlungsrunde nicht wieder scheitern zu lassen, wird dem joggenden Frühaufsteher Lamy nun offenbar von der Mehrheit der Mitgliedstaaten zugetraut.