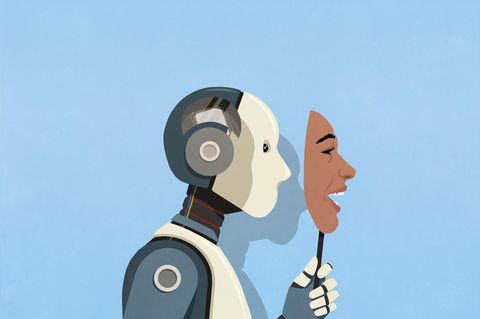Manchmal findet man im Abfall die interessantesten Dinge. So bekennt sich der Schriftsteller Max Goldt dazu, als Kind am liebsten im Müll gespielt zu haben. Und der Autor Axel Hacke hat einen äußerst erfolgreichen, so genannten Sprachwertstoffhof eingerichtet, auf dem seine Leser ihren Sprachmüll abladen können. In diesem Gerümpel aus schlecht übersetzten Speisekarten oder falsch verstandenen Liedtexten, so zeigt Hacke, verstecken sich oft die größten Schätze.
Seit Februar 2008 gibt es einen neuartigen "Wertstoffhof", eine neue Schatzkiste voller Info-Müll. Der Abfall besteht in diesem Fall aus Lexikonartikeln, weggeworfen von Wikipedia-Administratoren. Die Qualitätskontrolleure der freien Online-Enzyklopädie löschen täglich Hunderte Einträge, die sie zu trivial, zu tendenziös oder zu abseitig finden. Zum Glück für alle Abfall-Fans lösen sich die Artikel aber nicht in Luft auf, sondern werden automatisch auf der "Deletionpedia"-Seite eingespeist. Dort können sie in Ruhe ihr Info-Müll-Dasein fristen, rumänische Deathmetal-Bands neben einer Typologie der Bärte und Spielberichten von der WM 2002.
Über 60.000 Einträge sind schon auf Deletionpedia versammelt, jeweils versehen mit dem Grund für die Tilgung. Besonders skurrile Fundstücke stellen die Betreiber der Seite jeden Monat auf liebevolle Weise heraus. Im September war das beispielsweise die "Liste von Filmen mit Affen drin", mit dem Kommentar: "Birgt ein Potenzial, das Wikipedia nicht erkannt hat". Die Liste des Monats Oktober versammelt "Filme mit besonders langen Titeln" wie "Night of the Day of the Dawn of the Son of the Bride of the Return of the Revenge of the Terror of the Attack of the Evil".
Info-Müll bald auch auf Deutsch
Bislang gibt es Deletionpedia nur auf Englisch. Der Hamburger Zacharias Knoop arbeitet derzeit an einer deutschen Version (http://www.deletionpedia.de/), die am 15. November an den Start gehen soll. Anders als in der englischsprachigen Variante soll es hier auch die Möglichkeit geben, die Einträge zu kommentieren oder zu bewerten.
Die Geburt des Online-Lexikons Wikipedia im Jahr 2001 brachte gleichzeitig eine Frage auf, die bis heute nicht beantwortet ist. Wer oder was ist es wert, dass man ihm einen Lexikonartikel widmet? Wer entscheidet das? Und: Wenn der Platz im World Wide Web doch unbegrenzt ist, wieso soll nicht über jeden und alles etwas geschrieben werden können? Dieser Geburtsfehler, auch bekannt als Streit zwischen Inkludisten und Exkludisten, kann wohl so bald nicht behoben werden. Denn die Vertreter beider Standpunkte berufen sich auf Grundwerte Wikipedias: Die Exkludisten pochen auf die Vertrauenswürdigkeit, die das Lexikon zu verlieren habe. Sie wollen nur relevante Artikel aufnehmen, um ein gewisses Maß an Qualität garantieren zu können. Die Inkludisten halten dagegen, dass Wikipedia nicht auf Papier geschrieben sei, Bits und Bytes unbeschränkt verfügbar seien.
Deshalb spreche nichts dagegen, dass alle Dinge dieser Welt (und nicht nur dieser, sondern auch fiktiver Welten, etwa aus Computerspielen) festgehalten und in aller Ausführlichkeit beschrieben werden. Dieser Kulturkampf, so sieht es das Wall Street Journal, könnte mithilfe von Deletionpedia zu einem vorläufigen Ende kommen. Auch hier landet nicht ausnahmslos alles. Wenn Urheberrechte verletzt, Personen beleidigt oder die Texte zu viele Grammatikfehler aufweisen, will noch nicht mal die Online-Mülldeponie das haben.
Forschungsprojekt für Soziologiestudenten
Mit welcher Hingabe und Akribie so manche Fans sich ihrer universalenzyklopädischen Aufgabe widmen, kann man an vielen schönen Einträgen sehen, die Wikipedia als "Fancruft", also Fan-Müll deklariert. Darunter ist eine Aufstellung aller Strafarbeiten, die Bart Simpson im Laufe der Serie an die Tafel kritzeln musste.
Doch alle Akkuratesse nützt nichts: Für diese Fälle hält Wikipedia das Lösch-Prädikat "zu unwichtig", für ausführliche Charakterbeschreibungen von Personen aus Online-Rollenspielen "zu unwichtig in der fiktionalen Welt" bereit. Überhaupt tummelt sich eine ganze Menge an Rollenspielcharakteren auf Deletionpedia.
Doch Deletionpedia wartet nicht nur mit Skurrilitäten und manchmal sehr schönem Fan-Müll auf. Die US-amerikanische Zeitschrift The Industry Standard sieht in der Seite ein ausgezeichnetes potentielles Forschungsprojekt für Soziologiestudenten. Anhand der Löschdiskussionen lasse sich gut studieren, wie Gruppendenken funktioniert. Als Beispiel hätte um ein Haar auch der Wikipedia-Eintrag über Deletionpedia dienen können. Denn auch er war kurzzeitig ein Löschkandidat. Manche User befürchteten wohl, Wikipedia könne zu viel Kritik für seine Löschpraxis auf sich ziehen. Das kleine Lexikon ist dem großen offensichtlich nicht ganz geheuer. Vielleicht, weil manchmal gerade das interessant ist, was bei der Qualitätskontrolle durchfällt.
Abfall scheint jedenfalls nicht nur auf Schriftsteller eine große Faszination auszuüben. Seit einige Computermagazine über den "Friedhof der Wikipedia-Artikel" berichtet haben, ist die Seite ständig überlastet. Zu viele User wollen gerne im Müll spielen