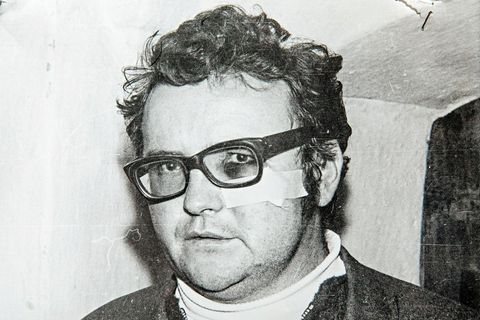Herr Schulz, Sie wollen den emeritierten Papst Benedikt wegen seiner Rolle im sexuellen Missbrauchsskandal der katholischen Kirche strafrechtlich zur Verantwortung ziehen. Was werfen Sie Joseph Ratzinger konkret vor?
Nicht ich will ihn zur Verantwortung ziehen, sondern einige meiner Mandanten. Es geht dabei nicht nur um Ratzinger als Person, sondern maßgeblich um die rechtliche Bewertung der zentralen Frage, ob er als Erzbischof von München-Freising sowie später als Präfekt der Glaubenskongregation im Vatikan und als Papst seiner Führungsverantwortung nachgekommen ist. Daran bestehen ausweislich der Aktenlage erhebliche Zweifel. Und ich bin mit diesen Zweifeln nicht allein.
Konkret geht es zum Beispiel um eine Sitzung im Jahr 1980, an der Ratzinger als Erzbischof von München und Freising teilgenommen haben soll. Dabei wurde über einen Priester gesprochen, der mehrfach wegen sexuellen Missbrauchs von Kindern auffällig geworden war und in Ratzingers Bistum wechseln sollte. Ratzinger hat zunächst behauptet, dass er an dieser Sitzung gar nicht teilgenommen hat – jetzt aber eingeräumt, dass diese erste Aussage falsch war: Er sei doch dabei gewesen. Was sagt das über die Glaubwürdigkeit des ehemaligen Papstes?

Es existiert ja ein Sitzungsprotokoll. Dieses belegt eindeutig, dass Ratzinger bei der fraglichen Sitzung sehr wohl anwesend war. Insofern wundert es mich, dass er zunächst das Gegenteil behauptet hat. Für mich ist das aber nicht wirklich entscheidend, denn Ratzinger ist heute 94 Jahre alt und Erinnerungslücken sind nicht in Abrede zu stellen, zumal seine erste schriftliche Stellungnahme im Missbrauchsgutachten ganz offensichtlich von Juristen geschrieben wurde. Unstreitig lag jedoch systemisch bedingtes Führungsversagen auf allen kirchlichen Hierarchieebenen vor, auch bei Ratzinger, weil der Schutz der Kirche und ihrer pädo-sexuellen Fußsoldaten Priorität vor potenziellen Opfern hatte. Die Kirche ist hier als pädokriminelle Vereinigung in Erscheinung getreten, die arbeitsteilig vorgegangen ist: Es gab die Täter und es gab diejenigen, die hinterher zuständig waren für das Abwiegeln, Vertuschen, Spuren verwischen, auch für das Einschüchtern und Ruhigstellen der Opfer. Das finde ich ziemlich widerlich.
Ratzinger wird jetzt auch von einigen deutschen Bischöfen scharf kritisiert.
Ja, und es ist schon bemerkenswert, dass nach Jahrzehnten des Schweigens jetzt massive Kritik an Ratzinger auch aus dem Vatikan selbst zu vernehmen ist. Die Zweifel fressen sich also vor, bis ins Herz der Kirche. Allseits wird davon gesprochen, dass Ratzinger durch die Feststellungen im Münchner Missbrauchsgutachten der Lüge überführt und ihm im Fall des Priesters H. womöglich sogar Beihilfe zu dessen Straftaten vorzuwerfen sei. Es geht hier nicht um Wegsehen oder bloße Nachlässigkeiten. Beihilfe ist ein strafrechtlich relevantes Verhalten, von dem auszugehen ist, wenn jemand "vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat", so das deutsche Strafgesetzbuch.
Sehen Sie den ehemaligen Papst schon vor Gericht?
Das ist von den dafür zuständigen Stellen zu prüfen, also in erster Linie von der Staatsanwaltschaft München. Möglicherweise muss sich auch der Generalbundesanwalt der Sache annehmen.
Dieses Gutachten zu studieren, war auch für mich eine neue, schockierende Erfahrung
Auf welcher rechtlichen Grundlage könnten die Vorwürfe geprüft werden?
Im Strafrecht kommen die Taten gegen die sexuelle Selbstbestimmung in Frage, weitere Ansatzpunkte bieten das Kirchenstrafrecht, das Zivilrecht und das deutsche Völkerstrafgesetzbuch.
Warum erwägen Sie den Weg über das Völkerstrafrecht?
Das deutsche Völkerstrafrecht unterscheidet sich in einem wesentlichen Punkt vom allgemeinen Strafrecht bei sexuellem Missbrauch: Es gibt dort keine Verjährung für diese Verbrechen. Allerdings gilt das nur für Taten, die ab dem 1.7.2002 begangen wurden. Einen interessanten Ansatzpunkt bietet außerdem die sogenannte völkerstrafrechtliche Vorgesetztenverantwortlichkeit.
Was bedeutet das?
Den Missbrauchsfällen liegt der kirchliche Gesamtvorsatz zugrunde, dass durch das Zölibatsgebot sexueller Missbrauch von minderjährigen Schutzbefohlenen stillschweigend geduldet und bei Bekanntwerden über die Befehls- und Hierarchieebenen totgeschwiegen oder vertuscht wurde. Mit der Rechtsfigur der Vorgesetztenverantwortlichkeit versucht man diejenigen zu fassen, die als Vorgesetzte der eigentlichen Täter mitschuldig sind an Verbrechen gegen die Menschlichkeit, ohne sich selbst die Finger schmutzig gemacht zu haben.
War Ratzinger ein solcher Schreibtischtäter?
Das wird zu prüfen sein. Seine Rolle im gesamten Missbrauchskomplex der katholischen Kirche ist zumindest dubios. Das habe ich jetzt bewusst vorsichtig formuliert.
Eine Münchner Anwaltskanzlei hat im Auftrag der Münchner Erzdiözese hunderte Fälle sexuellen Missbrauchs im Erzbistum München-Freising systematisch untersucht. Haben Sie das fast 1900 Seiten dicke Gutachten gelesen?
Ja. Ich habe wirklich schon einiges erlebt. Aber dieses Gutachten zu studieren, war auch für mich eine neue, schockierende Erfahrung. Man blickt in Abgründe, wenn man das liest. Dessen ungeachtet ist das Gutachten ein Meilenstein, der einerseits die Erosion in der katholischen Kirche vorantreibt. Aber andererseits, soweit jetzt absehbar, den Vatikan leider nicht zu einer vorbehaltslosen Straftataufarbeitung motiviert.
Der Missbrauch fand unter dem Deckmantel seelsorgerischer Fürsorge statt
Nicht nur Joseph Ratzinger trug jahrelang auf dem Bischofsstuhl Verantwortung im Erzbistum München-Freising, sondern später auch Kardinal Reinhard Marx. Wie beurteilen Sie seine Rolle im dortigen Missbrauchskomplex? Als Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz hat er sich sehr engagiert gezeigt bei dem Thema. Jetzt enthüllt das Gutachten, dass er als Erzbischof zumindest nicht ganz unbeteiligt war.
Seine Rolle war und ist nach wie vor sehr widersprüchlich. Obwohl das Münchner Gutachten von ihm in Auftrag gegeben wurde, erschien er nicht bei der Vorstellung der Ergebnisse. Warum er sich so verhalten hat, darüber mag man spekulieren. Vielleicht hätten ihn die Fragen von Journalisten in Verlegenheit gebracht? Die Rolle von Marx ist nicht unumstritten und bis heute nicht vollständig ausgeleuchtet. Seine konkrete Beteiligung in der Causa des Priesters H. wird derzeit untersucht. Das Ergebnis bleibt abzuwarten.
Ihre Mandanten werfen der Kirche vor, dass sie als Minderjährige von Priester Peter H. mehrfach sexuell missbraucht worden seien. Welches Bild ergibt sich aus den Schilderungen der Betroffenen?
Der Missbrauch fand unter dem Deckmantel seelsorgerischer Fürsorge statt. Das war gleichsam der Dark Room der katholischen Kirche. H. suchte seine Opfer gezielt nach einem Muster aus: Minderjährige, die sich in keinem stabilen familiären oder sozialen Umfeld befanden und mit kleinen Aufmerksamkeiten in sein pädo-kriminelles Netz gelockt wurden. Es wurde Alkohol verabreicht, es wurden Pornofilme gezeigt und einschlägige sexuelle Praktiken durchgeführt. Aufgrund der Autorität von H. gingen die Minderjährigen zumeist davon aus, dass diese Handlungen "normal" wären.
Was wissen Sie über den Täter Peter H.?
H. war ein skrupelloser Wiederholungstäter, dem es zuvorderst um die Befriedigung seiner sexuellen Triebe ging. Nie hat er das Unrecht seiner Taten eingesehen, sondern diese stets bagatellisiert und sogar der Kirche wegen seiner Versetzung von Essen nach München eine "Mit-Schuld" zugeschrieben. Denn, so H.: Wäre er nicht versetzt, sondern aus dem Priesteramt entfernt worden, hätte er ja keine weiteren Tatgelegenheiten mehr gehabt. Ich habe in meiner Tätigkeit als Anwalt viele Strafverfahren erlebt. Aber das ist nun wirklich eine dreiste, um nicht zu sagen perfide Einlassung, die auf ihn als mutmaßlichen Täter zurückfällt. Reue: Null. Empathie mit den Opfern: Fehlanzeige.
Was fordern Sie von der Kirche als Wiedergutmachung?
Die 27 Bistümer in Deutschland haben sich auf die Formel "Anerkennung für erlittenes Leid" verständigt. Das klingt gut, aber von einer "großzügigen Geste", die von der Kirche in Aussicht gestellt wurde, kann bisher keine Rede sein. Geschädigte, mit denen ich gesprochen habe, würden das Verhalten der Kirche nicht "großzügige Geste", sondern eher "chronischen Geiz" nennen. Kirchliche Missbrauchstäter blieben nämlich im Genuss ihrer Versorgungsansprüche und konnten selbst nach Verurteilung und Entfernung aus dem pastoralen Dienst ein finanziell sorgenfreies Dasein im Schatten der Kirche führen. Geschädigte hingegen mussten über Jahrzehnte für eine Anerkennung betteln und erhielten dann irgendwann eine bescheidene Ausgleichszahlung, die nicht ansatzweise in der Lage war, den tatsächlichen Schaden finanziell zu kompensieren.
Wie viel hat die Kirche Opfern bisher üblicherweise gezahlt?
In der Regel waren es früher 5000 Euro, dann wurden auf 7000, 8000 oder 9000 Euro erhöht, im Einzelfall waren es auch mehr.
Wie viel verlangen Sie für Ihre Mandanten?
Jeder Geschädigte sollte eine Million Euro erhalten.
Das ist sehr viel Geld.
Hier wurden Seelen zerstört – von Menschen, die als Seelsorger aufgetreten sind. Können Sie sich ein perfideres Verbrechen vorstellen?
Viele Opfer haben demütigende Erfahrungen hinter sich
Die Frage ist: Wie kann man eine zerstörte Seele finanziell messen?
Sie können das nicht. Aber wenn jemand so zerstört wurde, dass er später alkoholabhängig wurde, keine stabilen Vertrauensverhältnisse und Bindungen mehr aufbauen konnte, keine Familie gründen konnte, wenn jemand schwer traumatisiert und deshalb jahrelang nicht mehr arbeitsfähig war und daher später auch geringere Rentenansprüche hat – dann können Sie zumindest einen materiellen Schaden beziffern. Für den seelischen fehlt mir als Jurist die Kompetenz. Viel hängt auch vom Verhalten der Kirche ab.
Wieso?
Viele Opfer haben demütigende Erfahrungen hinter sich, sie wurden abgewimmelt, vertröstet, eingeschüchtert, wahlweise wie Nestbeschmutzer oder wie Bittsteller behandelt. Das hat nicht selten zu einer erneuten Re-Traumatisierung geführt. Umgekehrt können Anerkennung und Respekt den Schmerz auch lindern.
Welche Erfahrungen haben Ihre Mandanten gemacht, nach dem sie sich an die Kirche gewandt haben?
Keine guten. Man hörte sich auf Seiten der Kirche zwar geduldig die jeweiligen Tatschilderungen an, jedoch erfolgte die Anerkennung erlittenen Leids immer dann zeitverzögert, sobald damit die Erwartung von finanziellem Ausgleich verbunden war. Die Betroffenen fühlten sich als Bittsteller für eine milde Gabe. An warmen Worten seitens der Verantwortlichen fehlte es nie – aber sobald es um Geld ging, zeigte die Kirche ihre kalte Seite. Und sobald Betroffene rechtliches Terrain betraten, berief sich die Kirche formaljuristisch auf Verjährung und "unzureichenden Tatsachenvortrag". Damit war den Opfern klargemacht, dass sie juristisch keine Chance hatten. Und gut daran täten, die eher mickrigen Angebote der Kirche lieber anzunehmen – "ohne Anerkennung einer Rechtspflicht", wie es dann auch noch in den Kirchenformularen, die Geschädigte auszufüllen hatten, so schön heißt.

Ist dieser Umgang der Kirche mit den Opfern sexueller Gewalt Ihrer Einschätzung nach typisch?
Vor 2010 ganz sicher. Danach setzte allmählich eine strukturelle Veränderung ein, die jetzt wohl ihren vorläufigen Höhepunkt erreicht haben dürfte. Die Kirche zeigt sich schwer zerknirscht. Sie sagt einerseits: mea culpa, mea maxima culpa – meine große Schuld. Und schiebt die ganze Verantwortung gleichzeitig allein auf einen greisen Papst im Ruhestand.
Sie stehen als Anwalt in engem Kontakt mit Betroffenen. Wie geht es ihnen heute? Wie haben sie ihre Erlebnisse verarbeitet?
Das ist von Einzelfall zu Einzelfall sehr unterschiedlich. Ich habe jedenfalls noch keinen getroffen, der mir gesagt hat, dass das Kapitel Missbrauch für ihn erledigt und abgeschlossen ist. Menschen wie der Priester Peter H. haben bei jedem Opfer eine schwere Hypothek hinterlassen, die die Betroffenen ein Leben lang begleiten wird. Einige haben sich deshalb von der Kirche abgewandt und sogar den Glauben an Gott völlig verloren. Ich kann das vor dem Hintergrund, wie die Kirche mit den betroffenen Menschen umgegangen ist, durchaus verstehen.
Die Kirche lebt mental noch in den 1960er und 1970er Jahren
Geht das nach Ihrer Einschätzung vielen Missbrauchsopfern so?
Ich denke, ja.
Die katholische Kirche hat bis hinauf zu Papst Franziskus immer wieder ihre Erschütterung zum Ausdruck gebracht, eigene Aufklärungskommissionen eingesetzt, Entschädigungszahlungen und Opfern den Dialog angeboten. Man könnte sagen: Es wurde immerhin Reue gezeigt.
Echte Reue zeigt sich auch durch eine echte großzügige Geste in Form einer Anerkennungsleistung, die jenseits dessen liegt, was bisher finanziell angeboten wird. Die katholische Kirche in Deutschland hat ein geschätztes Vermögen von fast 500 Milliarden Euro. Der Einsatz von nur fünf Prozent dieser Summe für die mutmaßlich 4000 Geschädigten würde ein deutliches Signal setzen, dass es die Verantwortlichen in Deutschland ernst mit einer Straftataufarbeitung meinen. Aber neben vielen warmen Worten hat die Kirche eine wuchernde Anerkennungsbürokratie etabliert, die sich um den finanziellen Ausgleich der Betroffenen kümmert, personell unzureichend aufgestellt, mit extrem langen Bearbeitungszeiten. Geschädigte müssen oft jahrelang auf definitive Antworten warten. Die Sachbearbeitung für die Anerkennung erlittenen Leids und deren finanzielle Umsetzung erinnert an die Regulierungspraxis einer mittelmäßigen Versicherung: Bürokratie, Bürokratie, Bürokratie – und auf Zeit arbeiten, bis der Anspruchsteller entnervt aufgibt.
Sie haben als Anwalt schon Opfer und deren Angehörige vertreten, unter anderem nach dem Germanwings-Absturz, den NSU-Morden, dem Anschlag vom Berliner Breitscheidplatz. Was den Umgang mit den Opfern betrifft: Sind diese Fälle vergleichbar? Gibt es Parallelen?
Obwohl jeder Fall anders ist, haben alle etwas Gemeinsames: nämlich, dass Opfer und Betroffene immer das Nachsehen haben, weil unser Rechtssystem historisch täterzentriert ist. Im weltlichen Rechtssystem haben Opferrechte allerdings zuletzt eine maßgebliche Stärkung erfahren. Die Kirche lebt dagegen mental noch in den 1960er und 1970er Jahren.
Sie legen sich mit dem Vatikan an, dem Zentrum der katholischen Kirche. Haben Sie sich das auch gut überlegt?
Was soll passieren? Das haben andere vor mir auch getan. In die Hölle werde ich dafür nicht kommen – diese Plätze sind schon für andere reserviert. Eher bekomme ich ein Stellenangebot beim Jüngsten Gericht, denn letztlich trage ich zur inneren Reinigung der katholischen Kirche bei. So falsch können meine Aktivitäten also nicht sein.