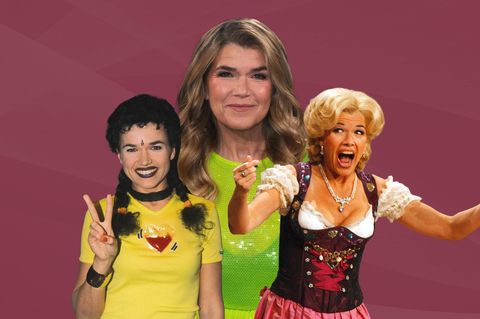Herr Hachmeister, Premiere hat gerade die Fußball-Bundesliga an den Newcomer Unity Media verloren. Wird Premiere überleben?
Ich kann diese Schockberichterstattung in den Medien nicht ganz nachvollziehen. Georg Kofler, der Geschäftsführer, hat sicherlich noch Verhandlungsmasse. In solchen Situationen gibt es ja nicht nur den Plan A, sondern auch B und C. Vermutlich wird es eine Einigung mit der Gruppe um Unity Media geben. Das ist bislang ein Unternehmen ohne Substanz und Erfahrung auf der Programm- und Produktionsseite. Es wird Unity & Co. gut tun, mit Premiere ins Geschäft zu kommen. Außerdem ist Bezahlfernsehen nicht nur von Fußball abhängig. Es geht darum, eine Premium-Marke aufzubauen. Das ist in Deutschland nicht glücklich gelaufen. Der amerikanische Pay-TV-Kanal HBO produziert hochkarätige Serien, die sich auch auf dem Weltmarkt verkaufen lassen. Das Abonnement von HBO ist ein Statussymbol.
Die besten Serien, von "CSI" über "Desperate Housewives" bis zu "Six Feet Under" kommen tatsächlich aus den Staaten. Warum gelingt es den Deutschen nicht, Ähnliches zu entwickeln?
In allen Sendern wird jetzt wieder darüber nachgedacht, intelligentere Serien zu entwickeln. Aber die Programmarbeit ist sehr angstorientiert, sehr defensiv. Wenn man mit dem Bewährten die besseren Erfahrungen bei der Publikumsmehrheit macht, wird jede Neuerung zu einer Bedrohung. Das kommerzielle Fernsehen steht immer noch unter dem Schock, nicht nur die Marktführerschaft verloren zu haben, sondern auch gesellschaftliche Beachtung, im Sinne von: schrill, ökonomisch potent, lebendig. Dieser Klassenclown-Effekt ist weg. Und die Primetime des öffentlich-rechtlichen Fernsehens sieht aus wie eine gut gepflegte Fußgängerzone der 70er Jahre. Was nicht heißt, dass man auch dort manchmal Überraschungen erleben kann. Aber sehr selten.
Dr. Lutz Hachmeister, 46,
war von 1989 bis 1995 Direktor des Adolf Grimme Instituts in Marl. Er leitete außerdem die Cologne Conference und war Jury-Vorsitzender des Deutschen Fernsehpreises.
Hachmeister ist Gesellschafter von HMR International, einer Beratungsfirma für Medienhäuser und produziert Dokumentarfilme ("Das Goebbels Experiment"). Derzeit dreht er für das ZDF ein 90minütiges Porträt des Literaturkritikers Marcel Reich-Ranicki. 2005 wurde Hachmeister Gründungsdirektor des Berliner Instituts für Medien und Kommunikationspolitik, das sich als "Think Tank" der Medienpolitik versteht.
… und in der Fußgängerzone treten immer wieder dieselben Moderatoren auf. Wo bleiben die Nachfolger von Kerner, Beckmann, Gottschalk und Co?
Solche Fragen kehren zyklisch wieder. Ich hatte in den 70er Jahren eine regelrechte Peter-Alexander-Phobie. Aber wir reden hier von Scheinproblemen, die sich von selbst lösen. Es findet schon ein Wechsel des Personals statt. Aber es bleibt in der Regel beim Typ Conferencier mit heiterer Harmlosigkeit. Wir haben mehr Frisuren als Köpfe, und die Fernsehshows sehen auch nicht anders aus als die Gesellschaft, aus der sie kommen. Was mir fehlt, ist ein Showmaster oder Moderator mit politischem Bewusstsein und anarchischen Tendenzen, so eine Kreuzung aus "Scheibenwischer" und Stefan Raab.
Gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen könnte mehr experimentieren, zumal es nicht vom Markt abhängig ist.
Ich bin da skeptisch. Zum einen spielen ARD und ZDF im gleichen Publikumsmarkt wie RTL oder Sat.1. Zum anderen stehen wir beim Personal vor dem größten Generationswechsel, den der öffentlich-rechtliche Rundfunk bislang erlebt hat. Viele Mitarbeiter, die noch härtere gesellschaftliche Spannungen und politische Konflikte erlebt haben, damit auch inhaltlich-publizistische Ziele hatten, scheiden jetzt aus. Stattdessen kommen 30- bis 45-jährige in Führungspositionen, die stark mit der Dominanz der Einschaltquoten und den Regeln mittlerer Programmsicherheit sozialisiert wurden. Sie setzen eher auf das, was schon mal funktioniert hat, im eigenen Programm oder im Ausland. Es wird ihnen schwer fallen, ein eigenes Profil zu entwickeln. Man bräuchte aber mehr Souveränität und Risikofreude bei den Führungsfiguren.
Derzeit leiden ARD und ZDF darunter, dass ihnen der Zuschauernachwuchs fehlt. Stirbt den Öffentlich-Rechtlichen das Publikum nicht ohnehin weg?
Was nicht funktioniert, sind Programminseln für Teens und Twens, "Jugendfernsehen". Aber eine Familienshow wie "Wetten dass, ...?" hat eine hohe Resonanz in allen Altersgruppen. Und es gibt viele Beispiele, vom "Marienhof" bis zur "Küstenwache", wie man mit einer geschickten Besetzungspolitik das Publikum verjüngen kann. Außerdem glaube ich, dass es selbst bei Menschen, die eher mit Privatfernsehen aufwachsen, im Alter von 30 bis 40 Jahren einen Switch gibt. Sie sind durchaus für die Öffentlich-Rechtlichen zu interessieren. Das ist eine Frage des Looks, der audiovisuellen Grammatik.
Was sollte die Privaten für Erwachsene uninteressant machen?
Die ganzen Regelverletzungen des privaten Fernsehens - das ist alles schon mal durchgespielt. Die Abfolge von Entrüstung und Desinteresse wird ja auch in den Medien immer schneller. Vor zwei Jahren wurde noch heftig debattiert, ob es ein Big-Brother-Dorf geben darf, in dem sich die Teilnehmer dauerhaft kasernieren lassen. Heute passiert das einfach. Aber es hat keine gesellschaftliche Wirkung mehr. Die Provokationen sind verpufft.
Ebenso wie beim Pay-TV steht auch im privaten Free-TV eine Umwälzung bevor, der Springer Verlag will ProSiebenSat.1 kaufen. Aber die Kartellbehörden sagen, dass Bild und Sat.1 nicht in einer Hand sein dürfen. Können Sie die Bedenken nachvollziehen?
Ich glaube nicht an die viel beschworenen Synergien. Diese Idee, Boulevardpresse und Fernsehen könnten Politik und Gesellschaft erheblich beeinflussen, stammt aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. Außerdem hatten wir diese Kombination im Prinzip schon einmal, als Leo Kirch ProSiebenSat.1 besaß und 40 Prozent am Springer Verlag hielt. Weder die "Hörzu" noch die "Bild" haben davon profitieren können. Natürlich könnte es in der Prominenz-Berichterstattung ein paar Überschneidungen zwischen der "Bild" und Sat.1 geben, aber: So what? Wer will heute noch ein "Promi" sein?
Also wird der Deal kommen?
Die Fronten beim Kartellamt und der KEK, also der Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich, sind offenbar verhärtet. Aber es gibt ja noch das Mittel der Ministererlaubnis - wenn Springer nach all dem Durcheinander überhaupt noch Lust hat, einen Deal zu machen, der ja auch ökonomische und strategische Risiken birgt. Wenn Springer zugunsten der Fusion Unternehmensteile verkaufen will, wie angekündigt, sollte es damit auch gut sein. Sonst müsste man sich auch fragen, wie es Bertelsmann schaffen konnte, die andere Hälfte des privaten Free-TV zusammenzukaufen. Die deutsche Medienaufsicht mit ihren zahlreichen Institutionen, die sich in der Medienpolitik gegenseitig auf den Füßen stehen, ist das eigentliche Problem. In den USA vernetzen sich gerade Google, Time Warner und der Kabelanbieter Comcast. Da baut sich wirklich Marktmacht auf.
Droht dem Fernsehen denn ernsthafte Konkurrenz aus dem Internet? Nachdem die Telekom die Bundesliga-Rechte für die Online-Verwertung gekauft hatte, befürchtete Kofler eine Art "Parallel-Pay-TV".
Der Auftritt der Telekom wird nur ein Zwischenspiel sein, wenn sich das Unternehmen nicht intensiver mit Programmen und Vertriebsstrategien beschäftigt als bisher. In naher Zukunft gibt es nur noch ein Distributionsnetz für Medien, "Internet-TV" ist ein Widerspruch in sich. Richtig interessant wird es, wenn man Fernsehsendungen zeitversetzt aus dem Netz laden kann. Das wird den Konsum weiter individualisieren und auf Kosten des "normalen" Fernsehens gehen. Schon jetzt ist ja interessant zu beobachten, wie viel Platz Fernsehserien auf DVD in den Regalen der Elektronikmärkte einnehmen.
Mit welchen Formaten wird das Fernsehen im kommenden Jahr Trends setzen können?
Ich glaube, dass im dokumentarischen Fernsehen noch viel mehr möglich ist - mit höheren Budgets, intensiverem Rechercheaufwand, präziserer Beobachtung von Politik und Alltag. Also nicht nur computergeneriertes Mittelalter, sondern Wissen um die Gegenwart und die nahe Zukunft. Ich glaube auch, dass es Gesprächssendungen geben wird, die über den klassischen "Talk" mit Prominenten hinausgehen, die sich mehr mit Wissen und Kultur im weiteren Sinne beschäftigen werden.
Sport wird jedenfalls reichlich zu sehen sein. Freuen Sie sich auf den medialen Wahnsinn der Fußball-WM?
Sehr. Ich mache dann auch wenig anderes neben dem Fernsehen. Aber ich sehne mich nach Kommentatoren wie Rolf Kramer vom ZDF. Der hat früher "Hoeneß" oder "Grabowski" gesagt und dann zwei, drei Minuten geschwiegen. So kam es einem jedenfalls vor. Keine überflüssige Fachsimpelei. Aber man hatte das gute Gefühl: Man schaut das Spiel nicht allein.