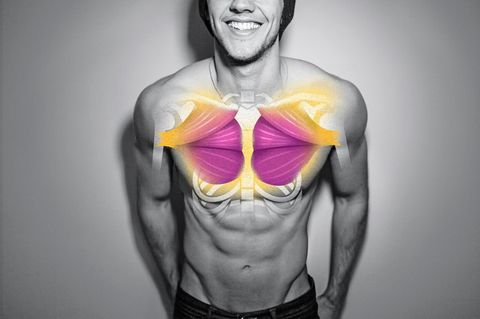Einmal im Jahr ist Zeugnistag. Und Mediziner, Verbandsfunktionäre und Politiker haben allen Grund, ihm mit Lampenfieber entgegenzusehen - die Zensuren werden öffentlich verkündet. Immer wenn der neue »Arzneiverordnungsreport« (AVR) erscheint, wird offenbar, ob die Akteure des deutschen Gesundheitswesens ihrer Pflicht gerecht geworden sind, sparsam mit dem Geld der mehr als 50 Millionen Beitragszahler in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) umzugehen. Beurteilt wird das von einem Team von Pharma-Experten um den Heidelberger Professor Ulrich Schwabe. In dieser Woche verkündet er zum 18. Mal das Urteil der Gelehrten*.
Gesundheitsministerin Ulla Schmidt, seit Januar letzten Jahres im Amt, hat das Klassenziel verfehlt: Um 10,4 Prozent stieg 2001 unter ihrer Ägide der Jahresumsatz bei Fertigarzneimitteln im GKV-Bereich. 21,3 Milliarden Euro rauschten durch die Apothekenkassen, ein Zuwachs von zwei Milliarden. Das 2,8-Milliarden-Euro-Defizit der GKV geht wesentlich auf den häufigeren Griff zur Pillenschachtel zurück: Seit Horst Seehofers ersten Spargesetzen Anfang der 90er Jahre hat es derartige Umsatzzuwächse im GKV-Pharmamarkt nie gegeben.
*Arzneiverordnungsreport 2002, Springer-Verlag Heidelberg, 1057 Seiten, 29,95 Euro
Auch die Ärzte, die in den vergangenen Jahren seltener zum Rezeptblock griffen - seit 1992 ging die Zahl ihrer Verschreibungen um etwa 30 Prozent zurück - erhalten diesmal schlechtere Noten. Zwar wurden 2001 erneut etwas weniger Verordnungen geschrieben als 2000 (ein Rückgang von einem mageren Prozent, der sich allein durch die sinkende Versichertenzahl erklärt), doch wurde das Durchschnittsrezept binnen Jahresfrist um 11,5 Prozent teurer. Gegenüber 1992 ergab sich gar eine Steigerung um 78 Prozent.
Die Pharmaindustrie begründet das mit der Neueinführung modernerer Medikamente: Für mehr Geld erhalte der Patient mehr Qualität, ein besseres und längeres Leben. In der Tat, so weisen Schwabe und Kollegen nach, sind patentgeschützte, also relativ neue Wirkstoffe, die Preistreiber. Im Bereich der nicht zu den Innovationen gehörenden Medikamente sind die Preise dank konsequenter Kontrollen seit 1989 nämlich um knapp 30 Prozent gefallen, bei den teuren Neuigkeiten aber stiegen sie um ein Viertel. Das müsste nicht sein, meint AVR-Herausgeber Schwabe: »Ich gönne jedem erfindungsreichen Unternehmen die Erlöse aus echten Neuerungen, denn die werden gebraucht, damit sich Forschung überhaupt rechnet«, sagt der Professor. Doch haben die AVR-Autoren eine Menge Präparate ausgemacht, die nur unwesentliche Verbesserungen bringen, aber dennoch schwer zu Buche schlagen: »Me-too-Arzneimittel«, auch Analogpräparate genannt. Das Prinzip, sich damit die Kassen zu füllen, erfreut sich unter Pharmakonzernen größter Popularität und hilft ihnen, die profitabelste Industrie der Welt zu bleiben.
Und so funktioniert's: Konzern A erfindet ein fortschrittliches Mittel, erprobt es in aufwendigen Studien, erhält ein Patent und vermarktet sein Präparat mit einer stattlichen Marge. Konzern B, der das Patent von Konzern A kennt, erfindet etwas Ähnliches, belegt in weiteren Studien, dass auch sein Präparat wunderbar wirkt, jedoch ein klein wenig anders - gerade ausreichend eben, um ein eigenes Patent zu erhalten. Fortan verkauft Konzern B seine Entwicklung in Deutschland ebenfalls als Novität und erwirtschaftet prächtige Gewinnspannen.
Das bekannteste Me-too-Präparat war der mittlerweile wegen gefährlicher Nebenwirkungen vom Markt genommene Bayer-Cholesterinsenker »Lipobay«. Bei seiner Einführung 1997 reihte er sich bereits in eine lange Kette gleichartiger Entwicklungen der Großkonzerne ein. Betriebswirtschaftlich war Lipobay eine richtige Idee: Auch 2001 zählten die Cholesterinsenker zur am stärksten gewachsenen Verordnungsgruppe. Sie wurden 13,2 Prozent öfter verschrieben als im Vorjahr. Aus Sicht der Beitragszahler aber ist das Me-too-Prinzip bedenklich. Denn die Analogpräparate sind mit durchschnittlich 70 Euro pro Verordnung viermal so teuer, wie es eine generische Variante (eine Kopie durch einen preiswerteren Arzneimittelhersteller) des ursprünglichen Mittels wäre, sobald dessen Patent abgelaufen ist. Würde der Gesetzgeber Me-too-Präparate nicht als innovative Produkte behandeln, ließen sich 2002 laut AVR 1,1 Milliarden Euro einsparen.
Mehr noch - 1,2 Milliarden Euro - könnte die Zulassung des Versandhandels mit Medikamenten bringen. Zwar kämpft die mächtige Apothekerlobby verbissen gegen diese Liberalisierung, doch zeigen Erfahrungen mit der niederländischen Versandapotheke »DocMorris« (stern Magazin Nr. 47/2001), dass eine zuverlässige Versorgung insbesondere chronisch Kranker (78 Prozent des Arzneimittelumsatzes entfallen auf nur 20 Prozent aller Patienten) per Fernapotheke gewährleistet werden kann.
Mit der Frage, ob Deutschland auf Arzneien weiterhin den vollen Mehrwertsteuersatz von 16 Prozent erheben sollte (nach Dänemark mit 25 und Österreich mit 20 Prozent ist das der dritthöchste in der EU), fasst der AVR ein weiteres heißes Eisen an. Die Experten errechnen, dass eine Umstellung auf den Steuersatz von 7 Prozent, wie für Lebensmittel oder Bücher, die GKV um 1,6 Milliarden Euro entlasten würde.
Die größte Stärke des AVR liegt jedoch in seiner schonungslos kritischen Beurteilung konkreter Arzneimittel aus fast 50 Anwendungsgebieten. So bemängeln die Verfasser am Allergiemittel »Aerius« (Wirkstoff Desloratadin), einer rechtzeitig zum Patentende seines eng verwandten Vorgängers »Lisino« auf den Markt gebrachten, neu patentierten Weiterentwicklung des bewährten Wirkstoffs Loratadin: Es habe »keine klinisch bedeutsamen Vorteile« gegenüber seinem Vorläufer, sei jedoch mehr als doppelt so teuer wie geeignete Generika.
Schärfer noch gehen Schwabe und Kollegen traditionell mit Mitteln ins Gericht, deren Wirksamkeit nicht mit zeitgemäßer wissenschaftlicher Strenge bewiesen wurde. Mit messbarem Erfolg: Seit Jahren verordnen Deutschlands Ärzte immer weniger dieser umstrittenen Präparate - dennoch wurden 2001 noch 1,9 Milliarden Euro mit ihnen umgesetzt. Ulrich Schwabe rät, sie durch geprüfte Alternativen zu ersetzen oder sie ganz zu streichen: »Ein Kompressionsstrumpf«, so der Professor, »wirkt besser als jede Venensalbe.«
Dass der AVR, den der Heidelberger Springer-Verlag in fünfstelliger Auflage verkauft, Jahr für Jahr gewaltige Anstrengungen von seinen Autoren verlangt, liegt auch an der chronischen Überflutung des deutschen Medikamentenmarktes mit rund 50.000 Fertigarzneimitteln - in Schweden sind es 3500, in Frankreich 7700. Zwar sollen gut 10.000 Altlasten bald vom Markt verschwinden, doch noch sorgen sie mit dafür, dass der Arzneizwischenhandel in Deutschland so teuer ist. Einzig die Schweiz bringt es in Europa auf derart aufgeblähte Großhandels- und Apothekenzuschläge wie die Bundesrepublik.
An Reform-Hebeln, die die Politik ansetzen könnte, fehlt es im Arzneimittelbereich nicht: 4,2 Milliarden Euro jährliche Ersparnis sind nach Schwabes Gesamtrechnung machbar. Wie weit die Sparpotenziale jedoch langfristig ausgenutzt werden, vermögen die AVR-Autoren nicht vorherzusagen. Denn der Normalzustand im deutschen Gesundheitswesen ist Lobby-Gezerre, Mikromanagement und Patchwork-Politik. Der AVR dokumentiert den Dauer-Missstand: Zwischen 1982 und 1997 wurden allein die Bestimmungen darüber, wie viel die Patienten bei Medikamenten zuzahlen müssen, siebenmal geändert (siehe Grafik). Das war genauso oft wie in den 59 Jahren davor.
Christoph Koch