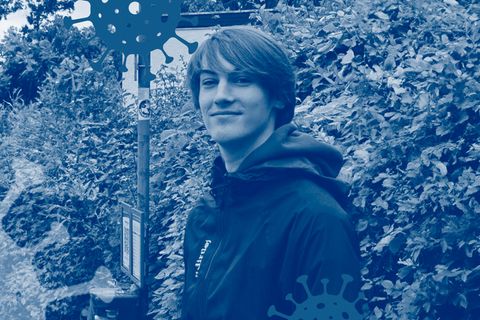Mit der Corona-Pandemie kam für viele Menschen der Lockdown – wir sollten zu Hause bleiben, Kontakte beschränken, ins Homeoffice gehen. Mit der Pandemie und dem Lockdown kamen aber auch psychische und wirtschaftliche Unsicherheit in der Bevölkerung. Das alles könne gesundheitliche Auswirkungen haben, meinen drei Forscher aus Dänemark. Sie warnen vor einer "Übergewichts-Epidemie", wie der dänische Fernsehsender TV2 berichtet.
Die Wissenschaftler sind der Ansicht, dass der umfassende Lockdown in großen Teilen der Welt aufgrund des Coronavirus einen fruchtbaren Boden für eine neue Finanzkrise geschaffen habe, deren Ausmaß noch unbekannt ist. Die Forscher Christoffer Clemmensen, Michael Bang Petersen und Thorkild I.A. Sørensen befürchten daher, dass eine der Auswirkungen der Pandemie eine verschärfte "Fettleibigkeits-Epidemie" beziehungsweise eine Zunahme an übergewichtigen Menschen sein könnte.
Soziale und psychologische Aspekte spielen eine Rolle
Die gestiegene Arbeitslosigkeit und die damit verbundenen Ängste und Unsicherheiten würden dazu beitragen, dass sich die psychischen und sozialen Verhältnisse vieler Menschen verschlechtern würden, denken die Forscher. Sie seien der Ansicht, dass eine schlechtere psychische Gesundheit in der Bevölkerung dazu führen könne, dass die Menschen mehr essen.
"Fettleibigkeit ist sehr komplex. Es geht nicht nur darum, wie viel wir essen, sondern auch um die sozialen und psychologischen Bedingungen, die wir haben", sagt Michael Bang Petersen, Forscher in biologischer Psychologie von der Universität Aarhus.
Zustimmung erhält er von seinem Kollegen Thorkild I.A. Sørensen, Professor am Metabolismuszentrum und der Epidemiologieabteilung der Universität Kopenhagen. Er sagt, dass Lockdowns eine deutliche Verschlechterung des Alltags vieler Menschen mit sich führen würden. "Wirtschaftliche und psychische Unsicherheit, Arbeitslosigkeit und dergleichen führen dazu, dass der Körper mit Stress reagiert, was die Fettleibigkeit erhöht. Der Körper gleicht die Anfälligkeit durch den Aufbau von Fettreserven aus, was aber auch das Risiko für Folgen wie Diabetes, Bluthochdruck und Herzinfarkte erhöht."

Umfrage: 38 Prozent der Deutschen bewegen sich weniger
Nach Informationen von TV2 hätten seit der Corona-Pandemie und dem Lockdown in Dänemark 38 Prozent der Erwachsenen aufgehört Sport zu treiben. Sørensen meint dazu: "Die Schließungen haben körperliche Aktivitäten erschwert. Es verschärft das Risiko einer gefährlichen Entwicklung von Fettleibigkeit." Die Forscher seien aber der Ansicht, dass das dänische Wohlfahrts- und Gesundheitssystem diese Entwicklung abfedern könne.
Laut der Weltgesundheitsorganisation WHO gilt man mit einem Body-Mass-Index von mindestens 25 als übergewichtig, adipös ab einem Wert von 30. Der BMI wird berechnet, indem das Gewicht durch die Körpergröße in Metern zum Quadrat geteilt wird. Nach Angaben des Statistikportals Statista waren im Jahr 2017 mehr als 36 Prozent der Deutschen übergewichtig mit einem BMI zwischen 25 und 30, 15,2 Prozent hatten demnach einen BMI zwischen 30 und 40.
Auch in Deutschland hätte der Lockdown Auswirkungen auf das Gewicht und Bewegung der Menschen, wie eine Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur Ende April dieses Jahres ergab. 38 Prozent der Erwachsenen in Deutschland würden sich deswegen weniger bewegen, 19 Prozent hätten infolge ihrer veränderten Gewohnheiten schon an Gewicht zugelegt. Nur 12 Prozent der Befragten seien demnach mehr in Bewegung als zuvor, 8 Prozent hätten wegen der Corona-Maßnahmen abgenommen.
"Bewegungsmangel begünstigt nicht nur die Entstehung von Übergewicht, sondern verringert auch körperliche Fitness, Koordination und Beweglichkeit", sagte Heidrun Thaiss, Leiterin der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung (BZgA), der DPA. "Zudem leidet auch die Psyche unter einem Mangel an Bewegung."
Deutsche ermuntert, mehr Rad zu fahren oder zu gehen
Es gebe aber auch positive Folgen: Seit Corona gibt es in vielen Familien mehr Zeit für gesunde Mahlzeiten. In der Umfrage gaben auch nur 13 Prozent der Erwachsenen an, sich ungesünder zu ernähren. Im Gegenzug sagten 12 Prozent, im Zuge der Coronakrise gesünder zu essen.
Dass mehr als sonst gegessen und genascht wird, etwa weil der Weg zum Kühlschrank im Homeoffice nicht weit ist, spielt zumindest nach Angaben der von YouGov Befragten kaum eine Rolle. Nur 15 Prozent gaben an, ihre Essensmenge sei gestiegen, 11 Prozent gingen sogar davon aus, im Zuge des Corona-Lockdowns insgesamt weniger zu essen. Allerdings ist da womöglich ein bisschen Fehleinschätzung im Spiel: Nach Angaben des internationalen Süßwarenhandelsverbands ist der Verkauf von Süßwaren in der Coronakrise gestiegen, im März sei ein zweistelliges Plus verzeichnet worden.
Eine Umfrage von Anfang Juli kommt hingegen zu einem anderen Bild: Ein guter Teil der Bevölkerung wurde durch die Krise demnach ermuntert, mehr mit dem Fahrrad zu fahren, Strecken auch mal zu Fuß, statt mit dem Auto zurückzulegen oder öfters bei Fitness zu Hause oder im Garten zu schwitzen. Zu diesem Ergebnis kommt eine repräsentative Umfrage im Auftrag der DKV Deutsche Krankenversicherung, wie die DPA berichtete.
22 Prozent gaben demnach an, dass sie in ihrer Freizeit nun mehr mit dem Rad fahren. Ähnlich groß war die Gruppe jener, die sich nach eigener Auskunft mehr zu Fitnesstraining zu Hause oder im Garten aufrafft. 26 Prozent berichteten, dass sie mehr Wege zu Fuß oder auf dem Rad zurücklegen statt Auto, Bus oder Bahn zu nutzen. 37 Prozent erklärten, mehr zu Spaziergängen aufzubrechen. Auch Joggen oder Walken wurde bei 15 Prozent etwas beliebter.
Lockdown für viele psychische Belastung
"Viele Menschen haben befürchtet, dass der notwendige Lockdown den schon vorher in Teilen der Gesellschaft vorhandenen Bewegungsmangel weiter verschärfen könnte", erklärte der Vorstandsvorsitzende der DKV, Clemens Muth. Die neuen Umfrage-Daten seien aus seiner Sicht daher eine positive Überraschung.
Neben der körperlichen Gesundheit in Corona-Zeiten wurde auch ein Blick auf die mentale Verfassung geworfen. Hier zeichnet die Studie ein eher dunkleres Bild. Mehr als ein Drittel (39 Prozent) gab an, dass die Einschränkungen durch die Coronakrise – sofern sie noch länger andauern – einen "eher negativen" oder "sehr negativen" Einfluss auf ihre mentale Gesundheit haben. Bei Menschen, die Kinder haben, war der Anteil sogar noch größer.
Als sehr belastend empfanden die Befragten vor allem den fehlenden Kontakt zur Familie außerhalb des eigenen Haushalts (25 Prozent) und auch zu Freunden (24 Prozent). 25 Prozent der Befragten gaben an, dass sie auch die wirtschaftliche Entwicklung für die Gesellschaft als sehr belastend einstufen. Interessanterweise sagten aber nur elf Prozent, dass sie die eigene wirtschaftliche Entwicklung sehr belaste. Das Arbeiten im Homeoffice sahen nur vier Prozent als große Belastung an.