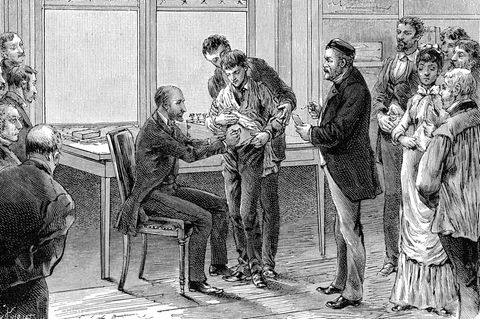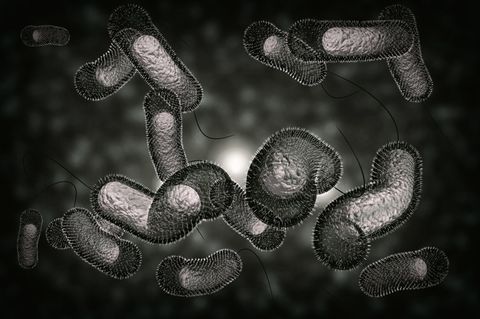Es war Samstag, der 13. August 1892, als ein Kanalarbeiter namens Sahling aus Hamburg- Altona mit rund 80 Kollegen am Siel arbeitete. Am Sonntag klagte er über Brechdurchfall. Am Montag war er tot. Am Dienstag starb ein weiterer Arbeiter, der Maurergeselle Kähler, im Eppendorfer Krankenhaus. Einen Tag später erkranken vier weitere Männer. Sie alle schufteten damals an einem großen Filterwerk, das das Trinkwasser aus der Elbe reinigen sollte. Denn die Abwässer der Stadt wurden einfach in die Elbe geleitet. Doch bevor diese dringend notwendige Anlage fertiggestellt wurde, brach die Cholera aus.
Die Seuche war für die Hanseaten nichts Neues. Schon in den Jahren 1831, 1866 und 1873 musste sich die Stadt mit der Krankheit rumplagen. Doch in dem sehr heißen und trockenen Sommer 1892 sollten Tausende an der Seuche sterben.
Cholera 1982 in Hamburg
Doch zunächst ergriff die Stadt keine Maßnahmen. Die Todesfälle am Hafen geisterten als Gerüchte durch die Gassen. Die Cholera solle wieder wüten. Ein Schiffszimmerer und ein Zigarrenarbeiter aus St. Pauli seien unter den Toten, hieß es. Wie genau die Reihenfolge der Tode ist, weiß heute keiner mehr. Erkrankte Matrosen hätten Hamburg per Schiff wieder verlassen können, ohne dass jemand von ihnen Notiz genommen hätte. Und Todesfälle in den dicht bebauten Vierteln am Hafen wurden kaum untersucht. Die Todesursache lautete dann einfach auf "Auszehrung" - ein Begriff, hinter dem sich Unterernährung, aber auch Krebs - oder die Cholera - verstecken konnte.
Die Zeitungen beschwichtigen: "In den letzten Tagen sind wiederholt Todesfälle vorgekommen. Dieselben wurden wenigstens noch am Sonnabend, amtlicherseits auf Cholerine oder, wie man auch sagt, Cholera nostras, zurückgeführt. Der rapide Verlauf der Krankheit trug freilich einen verdächtigen Charakter. Andererseits aber erschien wieder der Umstand beruhigend(!), daß die bisher gemeldeten 26 Erkrankungsfälle (in Wirklichkeit waren es bereits 450) nicht in einer und derselben Gegend, sondern an den verschiedensten Punkten der Stadt vorkamen, während eine wirkliche Epidemie gewöhnlich von einem Centrum ausgehend, sich von diesem aus verbreitet." In der heißen Jahreszeit kämen "Cholerine-Fälle vor", hieß es im Fremdenblatt. Kein Grund zur Sorge. Am 20. August erkennt der Stabsarzt Dr. Weisser, dass es sich bei der Krankheit um die gefährliche Cholera asiatica handele. Die Stadt reagiert immer noch nicht, bis zum 23. August sind bereits 450 Menschen erkrankt, 200 sind gestorben.
Cholera - ein grauenvoller Tod
Und diese Tode waren grauenvoll. Stundenlang entleerten sich die Körper von Stuhl und Erbrochenem, innerhalb weniger Stunden verloren die Menschen ein Viertel ihrer Körperflüssigkeit. Krämpfe und Schmerzen schütteln sie, die Nieren versagen, der Kreislauf bricht zusammen. Und dann waren sie auch schon bald tot.
Was zu diesem Zeitpunkt noch keiner weiß: Die Cholera-Erreger sind längst in die Wasserleitungen eingedrungen. Die Erkrankungen sind nur die Spitze des Eisbergs - denn die folgende Trinkwasser-Versuchung wird Hamburg schwer erschüttern.
Am 23. August geben die Behörden Seuchenalarm. Alte Kutschen werden aufgekauft, die Polster rausgrissen und zu notdürftigen Krankentransporten umgebaut. Erkrankte, die Cholera-Symptome aufweisen, sollen in die Krankenhäuser in Eppendorf und in der Lohmühlenstraße verlegt werden. Dort wurden Pavillions aufgebaut, um die Ansteckung zu minimieren. Ärzte müssen für ihre Patienten rote Formulare ausfüllen, die sogenannten Cholerazettel, um sie den Behörden zu melden. Die Zeitungen drucken täglich die Zahl der Erkrankungen und Todesfälle.
Auf Litfaßsäulen werden Belehrungen plakatiert, um den Menschen die Grundzüge der Desinfektion näher zu bringen. Ein kläglicher Versuch, sicherlich gut gemeint - und doch wirkungslos. Denn die Cholera wütetet vor allem in den Armenvierteln. Robert Koch, Entdecker des Cholera-Bazillus, wurde aus Berlin nach Hamburg geschickt, um sich ein Bild von der Epidemie zu machen. Und was er sah, schockte ihn zutief: "Ich habe noch nie solche ungesunden Wohnungen, Pesthöhlen und Brutstätten für jeden Ansteckungskeim angetroffen wie in den sogenannten Gängevierteln, die man mir gezeigt hat, am Hafen, an der Steinstraße, in der Spitalerstraße oder an der Niedernstraße." Und bringt es in seinem Brief an den Kaiser auf den Punkt: "Ich vergesse, dass ich in Europa bin."
Winzige Hinterhöfe und enge Gassen
Denn das, was er sah, waren Lebensräume, die den Ausbruch einer großen Epidemie verstärkten. Rund 24.000 Hafenarbeiter hatten einige Jahre zuvor ersatzlos ihre Wohnung verloren, um dem Bau der Speicherstadt weichen. Um weiterhin in der Nähe des Hafens - und somit des Arbeitsplatzes zu leben - mussten sie in winzigen Hinterhöfen und engen Gassen in der Neu- und Altstadt unterkommen. Sickergruben und Nachttöpfe waren hier verbreiteter als Wasserklosetts, in den dicht bebauten schmalen Gängen konnte sich die Cholera ausdehnen. Die hygienischen Standards befeuerten die Ausweitung der Krankheit. Daran konnten auch Desinfektionstrupps, mobile Garküchen zur Versorgung der Menschen mit nicht belasteter Nahrung und Pumpwagen mit Wasser nichts ändern.
Wer konnte, verließ die Stadt. So kommt das Leben in der Hansestadt zum Erliegen. Der Handel wird eingestellt, Schulen schließen - und auch am Hafen geht nichts mehr. Die nun arbeitslosen Hafenarbeiter finden aber schnell eine neue Beschäftigung: Auf dem Ohlsdorfer Friedhof müssen sie Gräber ausheben. 125 Arbeiter sind rund um die Uhr damit beschäftigt, meist sind es Massengräber. Allein am 27. August müssen mehr als 400 Menschen bestattet werden. "Du hast keinen Begriff, wie hier der schwarze Tod herrscht", schrieb der Dichter Detlev von Liliencron in einem Brief. "Geschrei, die Sanitätsbeamten alle besoffen, roh; der Kadaver wird aus den Häusern herausgerissen, einige Sanitätsbeamte sprengen mit großen Malerquasten, ob auf Tote oder Kranke, große Massen Chlorkalk." Tatsächlich schlingern auf den Straßen Betrunkene umher, denn es hält sich die Annahme, dass Alkohol vor einer Ansteckung schütze. Auch die Träger und Fahrer von Kranken- und Leichentransporten ertragen die grauenhafte Szenerie meist nur im Rausch.
Wie Hamburg auf die Seuche reagierte
Warum sich die Krankheit so rasend in der Stadt verbreiten konnte, darüber herrscht unter Historikern weitgehend Einigkeit. Osteuropäische Auswanderer sollen die gefährliche Krankheit unwissentlich im Gepäck gehabt haben. Russische Migranten verließen damals zu Tausenden das Zarenreich und wollten in die USA - und stiegen in Hamburg an Bord der transatlantischen Schiffe. Allein 1892 sollen rund 100.000 Auswanderer von Hamburg nach New York gebracht worden sein. Doch bevor es über den Ozean ging, warteten die Migranten in Holzbaracken ohne hygienische Standards oder suchten sich gleich ein Quartier in Hafennähe. So gelangte wohl der Cholera-Erreger ins Elbwasser.
Zehn Wochen rafft die Krankheit die Hamburger dahin. Fast 9000 Menschen starben durch die Seuche. Und die Stadt reagierte: Ein Filterwerk für Wasser aus der Elbe wurde 1893 fertiggestellt, eine Müllverbrennungsanlage folgte und ein Hafenarzt wird eingesetzt. Auch neue Baugesetze sollen verhindern, dass sich so ein Drama wiederholt.