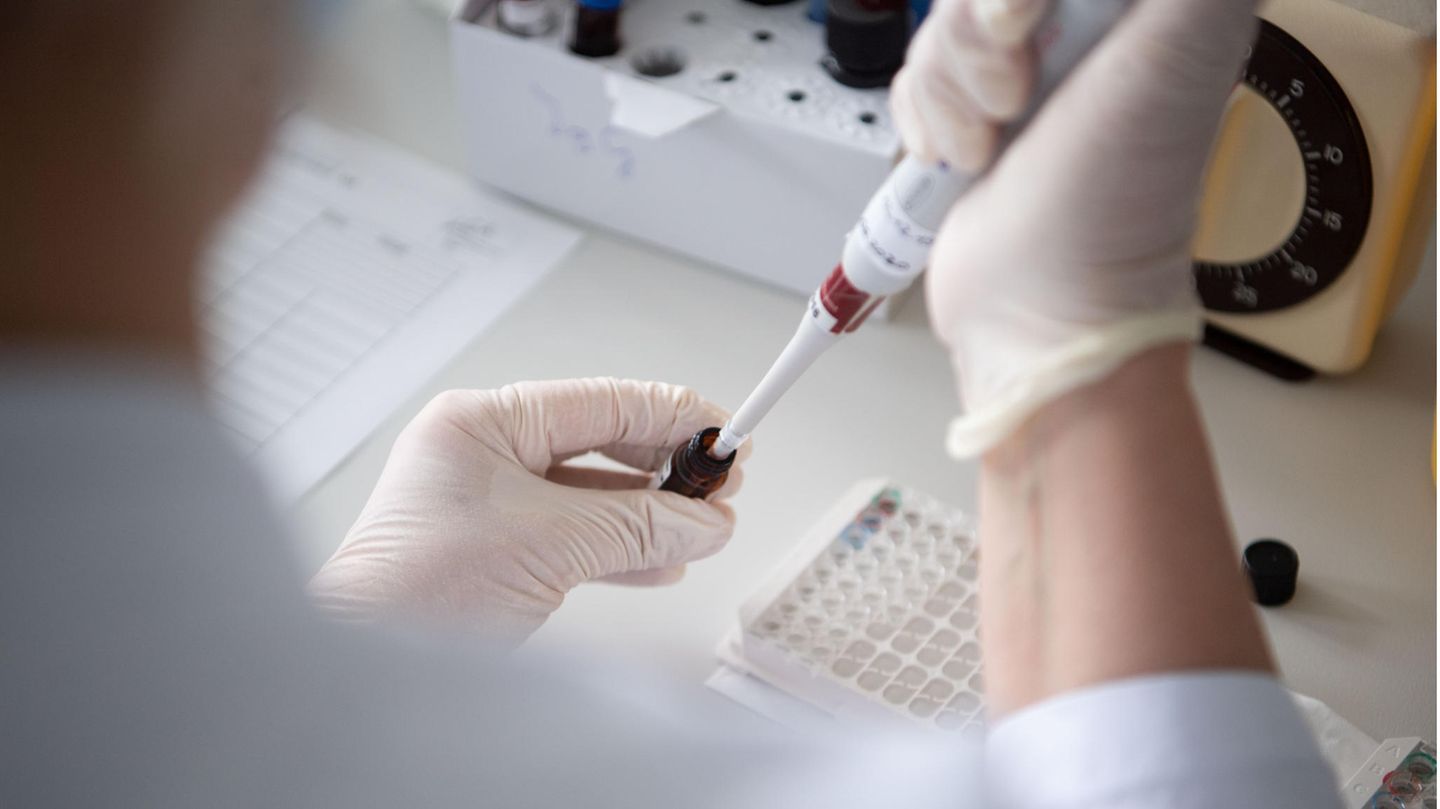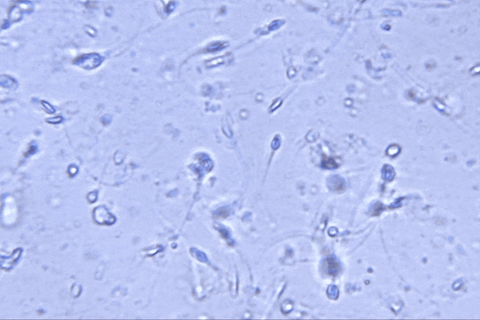Im Kampf gegen das Coronavirus gehören neutralisierende Antikörper zu den wichtigsten Helfern. Denn sie sind imstande, das Virus zu erkennen und daran zu hindern, in die Zellen einzudringen und sich dort zu vermehren. Sie arbeiten also wie körpereigene Türsteher. Der Körper produziert solche Antikörper, wenn er mit dem Virus in Kontakt kommt, also nach einer Infektion, aber auch nach einer Impfung. Je mehr Antikörper entwickelt werden, desto stärker ist die Gegenwehr gegen das Virus. Doch die Immunabwehr arbeitet bei jedem Menschen anders, das hat Auswirkungen auf die Immunität. Könnten Antikörpertests klären, ob ein ausreichender Schutz vorliegt?
Es wäre so einfach. Blut abnehmen, die Menge an Antikörpern prüfen und Sicherheit darüber haben, ob der Körper ordentlich gewappnet ist. Bei der Tetanus-Impfung ist das beispielsweise möglich. Anhand der Antikörperzahl im Blut und festgelegter Grenzwerte lässt sich sehr genau sagen, ob der Schutz noch ausreichend ist oder ob eine Auffrischungsimpfung nötig ist.
Auch im Kampf gegen das Coronavirus sind in Deutschland für den Herbst bereits solche Booster-Impfungen für Risikogruppen im Gespräch. Auslöser dafür sind zum einen Studien, die zu dem Schluss kamen, dass die Schutzwirkung des mRNA-Impfstoffs von Biontech/Pfizer sechs Monate nach der Zweitimpfung sinke und laut Hersteller daher "eine dritte Dosis innerhalb von sechs bis zwölf Monaten nach der vollständigen Impfung erforderlich sein" werde. Zum anderen macht die Delta-Variante des Virus Sorgen.
Ist der Immunschutz messbar?
Die Unsicherheit unter den Genesenen und Geimpften wächst. Doch wie gut und wie anhaltend der Immunschutz des Einzelnen ist, ist nicht so leicht zu bemessen. "Wir wissen noch nicht genau, was wir messen müssen, damit wir wirklich festzustellen können, ob jemand immun ist oder nicht", erklärte Immunologe Carsten Watzl gegenüber der "Deutschen Welle" (DW). Es sei zwar wahrscheinlich, dass die neutralisierenden Antikörper eine entscheidende Rolle spielen, "aber wie hoch die Anzahl dieser Antikörper sein muss, ist eben noch unklar".
Klare Grenzwerte für Antikörper gegen Sars-CoV-2 wurden noch nicht definiert. Das heißt, dass ein Antikörpertest zwar gemacht werden kann, das Ergebnis aber nicht weiterhilft, da es keine klaren Maßgaben gibt, an denen man sich orientieren könnte. "Viel hilft viel – das würde ich schon unterstreichen. Wo der Grenzwert liegt, ist aktuell noch nicht sicher und ab welchem Wert man wirklich geschützt ist. Aber da werden wir noch hinkommen", so der Immunologe.
"Antikörper liefern keine klare Aussage"
Georg Behrens, Facharzt für Innere Medizin und Immunologie an der Medizinischen Hochschule Hannover, rät dagegen von solchen Messungen ab. "Antikörper sind wichtig, liefern aber keine klaren Aussagen", sagte er der "Hannoverschen Allgemeinen Zeitung". Die Werte seien schwer zu interpretieren. Ein Antikörperspiegel, der den einen ausreichend schütze, sei unzureichend für einen anderen. Dazu komme, dass die Immunantworten sehr unterschiedlich ausfielen, manche ohnehin nur sehr wenige Antikörper entwickelten. Dabei mischen verschiedene Faktoren mit wie das Alter oder auch ein durch Medikamente unterdrücktes Immunsystem.
Außerdem sinkt der Antikörperspiegel mit der Zeit ab. Bei manchen schneller, bei anderen langsamer – vieles ist auch hierbei noch nicht bekannt. Und selbst Menschen mit einer hohen Antikörperkonzentration sind nicht hundertprozentig gefeit vor einer Infektion. Daher könnte ein solcher Test zwar eine Reaktion des Körpers auf eine Impfung nachweisen bei Menschen, die noch nicht mit dem Virus infiziert waren. "Um die Stärke oder Dauer des Impfschutzes nachzuweisen, eignen sich solche Tests aber nicht", so Behrens. Er plädiert für eine individuelle Einordnung der Werte.
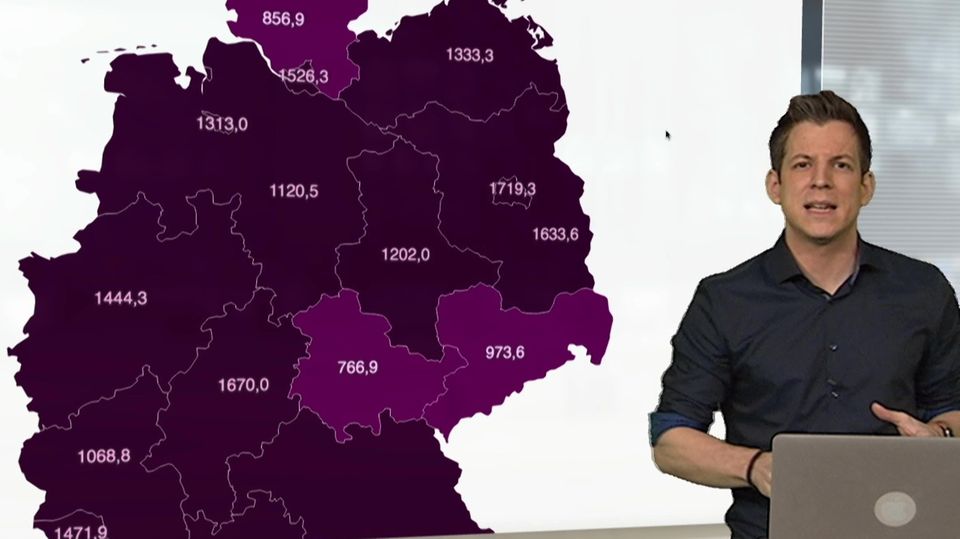
Komplexes Abwehrsystem
Die Zahl der Antikörper ist nicht das einzige Indiz, das Aufschluss über einen vorliegenden Immunschutz geben kann. Die neutralisierenden Antikörper sind nur ein Teil der Immunantwort. Auch die T-Zellen arbeiten gegen das Virus. Sie setzen ein, wenn das Virus bereits in die Zellen eingedrungen ist. Auch diese sogenannten Gedächtniszellen können das Virus erkennen. "Sie sind in der Lage, solche Virus-infizierten Zellen quasi umzubringen", so Watzl zur "DW. Die betroffenen Zellen werden also inklusive Virus abgetötet, das Virus selbst kann sich dann nicht weiter vermehren.
"Es kann durchaus sein, dass ich kaum Antikörper habe, sprich: Ich könnte mich noch mit dem Virus infizieren. Aber die Antwort meiner T-Zellen ist so stark, dass ich nicht schwer erkranke", so Watzl. Dies relativiert die Bedeutung der Antikörper und verdeutlicht, dass der Immunschutz von vielen Einflussfaktoren abhängig ist. Obschon Watzl davon ausgeht, dass eine hohe Konzentration von Antikörpern wohl auch für einen guten Schutz gegen Sars-CoV-2 spricht, heißt das nicht unbedingt, dass ein niedriger Antikörperspiegel mit einem geringen Immunschutz einhergeht.