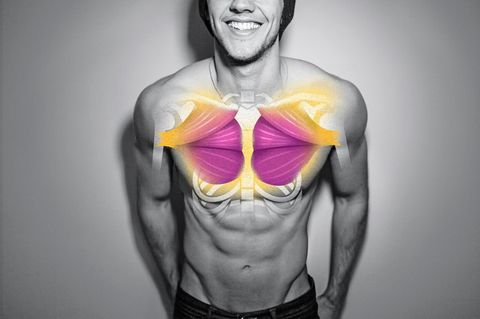Herr Lange, der noch amtierende Bundesgesundheitsminister Jens Spahn erklärte Ende Februar, das Gesundheitssystem in Deutschland sei angesichts der Pandemie "zu keiner Zeit" überlastet gewesen. Da war Deutschland gerade auf dem Weg aus der zweiten Welle. Teilen Sie diese Ansicht?
Die Aussage ärgert mich enorm. Sie stimmt einfach nicht. Ist es etwa keine Überlastung, wenn intensivpflichtige Patienten in andere Klinikbereiche verlegt werden müssen, damit ein Bett für einen anderen schwerkranken Menschen frei wird? Wenn Patienten nach einem Unfall oder einem Herzinfarkt teils von Klinik zu Klinik gefahren werden, ehe sie jemand aufnehmen kann? Oder wenn planbare Operationen verschoben werden, wie das bereits Ende 2020 der Fall war und aktuell wieder passiert? Sind all diese Beispiele keine Anzeichen für ein überlastetes Gesundheitssystem?
Sie arbeiten als Intensivpfleger in Leiharbeit in verschiedenen Berliner Kliniken, vor allem solchen mit Corona-Patienten. Geben Sie uns einen Einblick: Wie sieht es aktuell auf den Stationen inmitten der vierten Welle aus?
Der Personalnotstand ist groß und schlimmer als in den Wellen zuvor. Das verschärft die Situation. Viele Intensiv-Pflegekräfte haben den Beruf verlassen oder sind in andere Klinikbereiche gewechselt, wo sie weniger Belastungen und Stress ausgesetzt sind. Dadurch fehlt Personal auf den Intensivstationen und es gibt viel weniger freie Betten als zuvor. Und damit meine ich nicht Betten, die in Zimmern rumstehen. Von denen haben wir genug. Ich meine Betten, die von geschultem Fachpersonal betreut werden können. Das ist das große Problem.
Was bringt die Pflegerinnen und Pfleger dazu, ihren Job zu verlassen?
Die Hoffnungslosigkeit. Viele Pflegerinnen und Pfleger hatten zu Beginn der Pandemie noch die Illusion, dass sich nun endlich etwas ändert. Dass die Politik den Personalnotstand angeht, dass sich die Arbeitsbedingungen verbessern. Selbst ich war so naiv und glaubte daran, denn immerhin blickte ja jeder auf uns. Menschen standen auf Balkonen, um für uns zu klatschen. Und nun, nach der Bundestagswahl und inmitten der vierten Welle, ist diese Hoffnung verpufft. Da gibt es kein Licht mehr am Ende des Tunnels. Die, die noch da sind, versuchen den Laden am Laufen zu halten, springen noch häufiger ein als sonst, weil sie das fehlende Personal kompensieren müssen. Die Menschen sind körperlich und mental erschöpft. Die Motivation ist am Boden.
Corona verschärft Personalmangel in der Intensivpflege
Eine aktuelle Umfrage des Deutschen Krankenhausinstituts (DKI) wirft ein Schlaglicht auf die Situation in der Intensivpflege. Demnach geben knapp drei von vier befragten Kliniken an, durch Kündigungen, interne Stellenwechsel oder Arbeitszeitreduktionen weniger Intensivpflegepersonal zur Verfügung zu haben als noch Ende 2020.
86 Prozent der Häuser konnten in diesem Jahr ihre Intensivbetten wegen eines Mangels an Pflegekräften nicht immer voll umfänglich betreiben, geht aus der Umfrage hervor. Gut die Hälfte der befragten Kliniken gibt an, dass dies "oft" oder "sehr oft" der Fall war. Drei von vier befragten Kliniken berichten zudem, dass sie seit Beginn des Jahres vermehrt zusätzlich aushelfende Pflegekräfte von Normalstationen auf den Intensivstationen einsetzen, um die Versorgung insbesondere von Covid-19-Patienten zu gewährleisten. Bei einem Drittel ist das "oft" oder "sehr oft" der Fall. An der Repräsentativbefragung beteiligten sich bundesweit 233 Krankenhäuser.
"Die Abwanderungen führen in vielen Krankenhäusern dazu, dass die verfügbaren Intensivbetten zumindest zeitweise nicht vollständig betrieben werden können bzw. die Zahl der betreibbaren Intensivbetten insgesamt rückläufig ist", heißt es in der Umfrage. Die Änderung der Pflegepersonaluntergrenzen-Verordnung, die seit Jahresbeginn strengere Mindestbesetzungen bzw. Personalschlüssel in der Intensivpflege vorsehe, verschärfe die Lage zusätzlich.
Die meisten Corona-Patienten auf den Intensivstationen seien ungeimpft, schreibt das DKI weiter. Eine Möglichkeit, das Intensivpersonal und die Intensivstationen "spürbar" zu entlasten, sieht das Institut daher in einer höheren Impfquote.
Gleichzeitig sind die Fallzahlen hoch, und auch die Intensivstationen füllen sich. Die Ärztekammer in Sachsen warnt bereits vor einer möglichen Triage. In den Kliniken müsste dann entschieden werden, wem noch geholfen werden kann, wenn es mehr Patienten als freie Betten gibt. Haben Sie Angst vor einer solchen Situation?
Für mich wäre das eine Katastrophe, ein grausiges Szenario. Ich hoffe, dass wir nie an diesen Punkt gelangen. Aber das Traurige ist ja: Müssten Kliniken unter dem Druck der aktuellen Corona-Welle Triage anwenden, dann weil Personal fehlt und die Politik nicht auf den Hilferuf der Pflege gehört hat. Wir reden hier ja nicht über Betten, die nicht existieren. Wir reden nicht von Beatmungsgeräten, die nicht hätten angeschlossen werden können. Wir reden von Betten, Intensivbetten, die leer stehen, weil kein Personal da ist. Und ich möchte betonen: Das führt bereits zu Engpässen in Kliniken, die vielleicht nicht gemeinhin als Triage gelten, die aber eine Priorisierung nötig machen.
Können Sie das näher erklären?
Unter Triage verstehen die meisten Menschen eine Situation, in der Kliniken komplett überlastet sind und die Teams vor Ort entscheiden müssen, wer leben darf und wer sterben muss. Aber Triage fängt ja schon im Kleineren an, subtiler – übrigens schon vor Corona, aber seit Corona erst recht. Es ist ja auch eine Form von Triage, wenn Stationsärzte überlegen müssen, welchen Patienten sie am ehesten von der Intensivstation nehmen können, um ein freies Bett für einen anderen schwerkranken Patienten zu schaffen. Auf jeder Station gibt es diesen einen sogenannten "Joker"-Patienten: eine Person, die eigentlich auf die Intensivstation gehört, die aber im Notfall wegverlegt wird, einfach weil es ihr Zustand am ehesten zulässt. Diese Verlegungen passieren täglich. Das müssen die Leute einfach wissen.
Wohin kommt dieser Patient?
Auf einen provisorischen Intensivbettenplatz. Einige Kliniken nutzen dafür zum Beispiel den Aufwachraum eines OPs. Es werden auch sogenannte Überwachungsstationen zu Intensivstationen umfunktioniert. Auf einer Überwachungsstation liegen normalerweise Patienten, deren Zustand nicht schlecht genug für die Intensivstation ist, die aber auch nicht mehr auf einer Normalstation liegen können. Und dorthin werden dann intensivpflichtige Patienten gebracht, die teilweise eine Dialyse haben, die teilweise Narkosemedikamente bekommen, die im künstlichen Koma liegen und und und. Das sind Patienten, die eigentlich auf eine Intensivstation gehören.
"Das glaubt uns sonst niemand": Warum ein Intensivpfleger nach Schichtende zur Kamera griff
Was macht das mit Ihnen?
Es ist ein blödes Gefühl, mitunter auch erschreckend, wenn ich weiß, dass der Zustand des Patienten eigentlich nicht gut ist, er aber verlegt werden muss. Ich bin sehr froh, dass wir Pflegekräfte diese Entscheidungen – Wen nehmen wir auf? Wer wird verlegt? – nicht treffen müssen, sondern die Stationsärzte.
Wie blicken Sie auf die kommenden Wochen?
Verbittert, ich kann es nicht anders sagen. Es ist jetzt schon der zweite Sommer vergangen, ohne dass sich die Politik um den bevorstehenden Winter gekümmert hat. Es wurde Wahlkampf gemacht und so getan, als gäbe es keine Pandemie – obwohl ein Herr Wieler und ein Herr Drosten, also führende Experten, immer wieder davor gewarnt haben, dass die Zahlen im Winter erneut steigen werden. Man hat das Virus einfach kommen lassen. Ich verstehe auch nicht, warum wir immer noch über den Personalnotstand in der Pflege diskutieren müssen – im zweiten Jahr der Pandemie. Alle Maßnahmen, die zur Eindämmung der Pandemie getroffen wurden, wurden immer damit begründet, das Gesundheitssystem müsse vor Überlastung geschützt werden. Und da, wo man wirklich angreifen müsste – dem Flaschenhals Pflege – wird einfach nichts gemacht. Das ist zum Verrücktwerden.
Was würden Sie den Politikern von Bund und Ländern gerne sagen?
Es gab einmal Zeiten, da machten sich alle Gedanken darüber, woher wir neues Pflege-Personal kriegen. Über diesen Punkt sind wir längst hinaus. Wir müssen das Personal, das jetzt noch da ist, erstmal versuchen zu halten. Hinter uns gibt es keine zweite Reihe, es gibt keinen Ersatz. Wir sind die einzigen, die noch da sind. Wenn wir weg sind, sind wir weg.