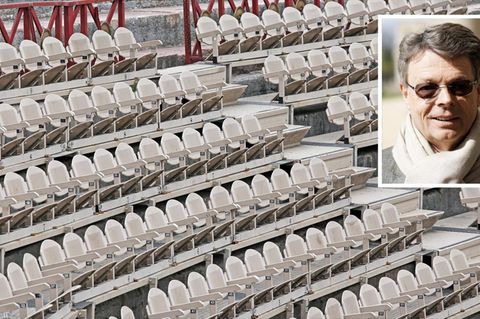Es war nur ein Toter, aber er versetzte die USA in eine regelrechte Panik. Sein Name war David Lewis, er war achtzehn Jahre alt und gerade als Gefreiter nach Fort Dix in New Jersey gekommen. Am 4. Februar 1976 brach er während eines Fünf-Meilen-Marschs zusammen, wurde ins Lazarett gebracht und starb dort einige Stunden später. Die Diagnose: Grippe mit schwerer Lungenentzündung. Eine Untersuchung der amerikanischen Seuchenkontrollbehörden (CDC) ergab, dass es sich um ein Schweinegrippevirus handelte, möglicherweise identisch mit dem Erreger, der 1918 als Spanische Grippe um die Welt gegangen war und nach Schätzungen zwischen 20 und 100 Millionen Menschen das Leben gekostet hatte. Es erkrankten weitere Menschen in Fort Dix, eine Krisensitzung jagte die nächste, immer wieder wurde der Vergleich mit 1918 gezogen, debattiert welche Maßnahmen ergriffen werden sollten.
Am 24. März verkündete der amerikanische Präsident Gerald R. Ford ein Impfprogramm in die Wege zu leiten, "um jeden Mann, jede Frau und jedes Kind in den Vereinigten Staaten impfen zu lassen". Bis Mitte Dezember wurden 40 Millionen Amerikaner geimpft, dann wurde die Aktion abgebrochen. Der Grund: Hunderte geimpfte Menschen waren an der entzündlichen Nervenkrankheit Guillain-Barré-Syndrom erkrankt, die mit Lähmungserscheinungen einhergeht.
Neuen Wirkstoffe an zu wenig Patienten getestet
Bis heute ist nicht klar, ob die Erkrankung auf die Impfung zurückgeführt werden kann. Volker ter Meulen, Präsident der Leopoldina und Virologe, glaubt nicht an einen Zusammenhang zwischen Impfung und Guillain-Barré-Syndrom. Johannes Löwer, Präsident des Paul-Ehrlich-Institus, das für die Zulassung von Impfstoffen verantwortlich ist, ist vorsichtiger: "Normalerweise wird das Guillain-Barré-Syndrom durch Infektionen ausgelöst, in sofern ist es nicht ganz von der Hand zu weisen, dass eine Impfung das auslösen könnte." Einige Forscher glauben, es habe sich damals um eine Verunreinigung des Impfstoffes mit Bakterien gehandelt. Die Impfstoffe, die heute hergestellt werden, seien besser gereinigt, sagt Marie-Paul Kieny, Direktorin der Abteilung für Impfstoffforschung bei der Weltgesundheitsorganisation (WHO). Sie rechnet deswegen auch nicht damit, dass es bei der bevorstehenden weltweiten Impfaktion gegen Schweinegrippe solche Nebenwirkungen geben wird. "Natürlich kann man das aber erst dann mit letzter Sicherheit sagen, wenn eine riesige Zahl von Menschen geimpft worden ist", sagt sie.
Und genau das ist ein großes Dilemma für die Verantwortlichen. Natürlich sind die Impfstoffe vorher gründlich getestet worden, um sicherzustellen, dass es keine unvorhergesehen Risiken gibt. Mit welchen Nebenwirkungen häufig zu rechnen ist, das geht aus den öffentlichen Beurteilungsberichten der vier Impfstoffe bei der europäischen Arzneimittelagentur EMEA hervor: Schmerzen und Rötung an der Injektionsstelle, Kopfschmerzen, Schwitzen, Gelenkschmerzen, Muskelschmerzen. Ganz normale Reaktionen des Immunsystems auf den simulierten Angriff durch Krankheitserreger, sagt Stefan Kaufmann, Leiter des Max-Planck-Instituts für Infektionsbiologie in Berlin. Diese häufigen und harmlosen Nebenwirkungen könnten bei jedem Zehnten Geimpften auftauchen.
Es sind aber vor allem die selteneren Nebenwirkungen, die Experten Kopfzerbrechen bereiten. Denn bei Millionen Geimpfter könnten auch Nebenwirkungen auftreten, die in den klinischen Studien gar nicht auftauchten. "Es gibt eine Faustregel die sagt: Wenn eine Nebenwirkung bei jedem Tausendsten auftritt, dann taucht sie bei einer Studie mit 3000 Menschen mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent auf", sagt Löwer. "Wenn nur einer von zehntausend Menschen eine bestimmte Nebenwirkung erleidet, dann muss man schon 30.000 Menschen vorher testen, wenn das Risiko mit einer Wahrscheinlichkeit von 95 Prozent auftauchen soll." Die neuen Impfstoffe wurden allerdings an erheblich weniger Patienten getestet.
Reine Statistik
In den klinischen Studien zu Celvapan, einem Impfstoff der Firma Baxter, etwa erhielten insgesamt 796 Personen die nötigen zwei Impfstoffdosen. Der Hersteller geht davon aus, dass dies ausreicht, um Nebenwirkungen aufzuspüren die bei etwa jedem Hundertsten auftreten. Seltenere Nebenwirkungen hingegen könnten bei den Tests nicht aufgefallen sein. Ähnlich sieht es für die anderen Impfstoffe aus. Pandemrix von Glaxo-Smith-Kline wurde insgesamt an 4002 Probanden getestet. Rein rechnerisch könnten damit immer noch Nebenwirkungen entgangen sein, die alleine in Deutschland 50.000 Menschen betreffen würden. Das bedeutet natürlich nicht, dass es diese Nebenwirkungen geben wird. Sie lassen sich im Vorhinein aber kaum ausschließen. "Das ist reine Statistik", sagt auch Kaufmann. "Alles was seltener auftritt als etwa einmal pro Zehntausend oder zwanzigtausend Geimpften lässt sich in klinischen Studien schwer erfassen."
Auch der Impfstoff Nasalflu der Schweizer Firma Berna, der im Herbst 2000 in der Schweiz eingeführt wurde, zeigt diese Schwierigkeit. Er wurde nach umfangreichen Tests zugelassen, aber nach einem Jahr wieder zurückgezogen, weil es zu einer Häufung von Gesichtslähmungen kam, die offenbar in Zusammenhang mit dem Impfstoff stand. Eine Studie, die 2004 im Fachblatt "New England Journal of Medicine" erschien, kam zu dem Schluss, dass die Nebenwirkung zu selten war, als dass sie bei den Tests vor der Einführung hätte gefunden werden können.
"Was wir hier erleben, ist ein Großversuch an der deutschen Bevölkerung", sagte der Herausgeber des "Arznei-Telegramms", Wolfgang Becker-Brüser, dem Nachrichtenmagazin "Spiegel". Die bisherigen Sicherheitstests der Musterimpfstoffe seien nur darauf ausgelegt, Nebenwirkungen zu erkennen, die in mehr als einem Prozent der Fälle auftreten. Dies bedeute bei 25 Millionen geimpften Deutschen "theoretisch", dass fast 250.000 Menschen eine "schlimme Impfreaktion" erleiden könnten, ohne dass diese in den vorherigen Tests aufgefallen wären. "Wir werden die Nebenwirkungen deswegen sehr intensiv beobachten" sagt Löwer. Das sei für Impfaktionen auch normal. In Erweiterung der drei Testphasen, die ein Impfstoff durchlaufen muss, ehe er zugelassen wird, spricht man von der vierten Phase. Darum konnte auch im Fall von Nasalflu so schnell gehandelt werden. Es stelle sich dann aber ein anderes Problem, sagt Löwer. "Wenn wir viele Menschen impfen, dann werden manche Leute ganz zufällig bestimmte Krankheiten bekommen, ohne dass es etwas mit der Impfung zu tun hat." Man müsse daher sehr genau beobachten, wie viele Fälle einer bestimmten Krankheit normalerweise zu erwarten seien. Sonst mache man die Impfung auch für eine Nebenwirkung verantwortlich, die in Wirklichkeit nur zufällig bei jemandem auftrete, der sich kurz zuvor habe impfen lassen.
Auf Seite 2 lesen Sie, warum das Zulassungsverfahren für die Impfung gegen Schweinegrippe kürzer ist und warum die Impfempfehlung für Schwangere und Kinder ein Dilemma darstellt.
Das Zulassungsverfahren wird im Fall der Schweinegrippeimpfung ohnehin anders sein als üblich - sonst gäbe es überhaupt keine Chance schon zur Wintersaison eine Impfung bereitzustellen. "Eine Zulassung zieht sich in der Regel über ein Jahr hin", sagt Löwer. Mit Blick auf eine Grippepandemie, bei der schnell gehandelt werden muss, haben die Pharmakonzerne aber Musterimpfstoffe entworfen. Das sind Impfstoffe für ein bestimmtes Grippevirus, die für andere Grippestämme abgewandelt werden können. Zurzeit sind in Europa vier solcher Musterimpfstoffe zugelassen: Focetria der Firma Novartis, Celvapan der Firma Baxter sowie Daronrix und Pandemrix der Firma Glaxo-Smith-Kline.
Alle vier sind zwar gegen das Vogelgrippevirus H5N1 gerichtet und dafür klinisch getestet worden. Um gegen die Schweinegrippe eingesetzt werden zu können, müssen aber lediglich die abgetöteten H5N1-Viren durch Schweinegrippeviren ersetzt werden. Die restlichen Bestandteile bleiben gleich. "Die Impfstoffe sind also schon ausführlich getestet worden, nur eben mit einem anderen Grippestamm", sagt Löwer. Daher sei deutlich weniger Zeit nötig für die Zulassung. "Wenn die Zulassungsdaten da sind, könnte der Impfstoff deswegen schon nach zwei bis vier Wochen zugelassen sein." Dann kann mit der Impfung begonnen werden.
Weniger Grippeviren pro Dosis nötig
Die Musterimpfstoffe benutzen allerdings eine neue Methode, um das Immunsystem gewissermaßen "scharf zu machen". Bisher wurde dafür in der Regel eine Substanz namens Aluminiumhydroxid verwendet. Die Musterimpfstoffe benutzen eine neue Technik, die das Immunsystem stärker aktivieren soll. Der Vorteil: Es werden weniger Grippeviren pro Dosis Impfstoff benötigt. So kann in kürzerer Zeit mehr Impfstoff hergestellt werden. Außerdem verbreitert sich die Antwort auf die Krankheitserreger, so dass auch etwas abgewandelte Formen der Erreger noch vom Immunsystem erkannt werden. Zumindest theoretisch könnte das aber auch die Gefahr erhöhen, dass Immunzellen körpereigene Stoffe erkennen und sich gegen den eigenen Körper wenden. "Das ist praktisch noch nicht nachgewiesen worden, aber grundsätzlich möglich", sagt Löwer.
Unter den vielen Geimpften sollen nach Willen der WHO vor allem auch schwangere Frauen sein. Sie haben ein erhöhtes Risiko, dass die Schweinegrippe-Infektion schwer oder sogar tödlich verläuft. Außerdem deuten neue Studien an Mäusen daraufhin, dass eine Grippeinfektion während der Schwangerschaft auch das ungeborene Kind schädigen könnte. Für die Zulassungsbehörden ist das ein Dilemma - denn Medikamente werden aus ethischen Gründen nicht an schwangeren Frauen getestet. "Wir werden uns die Daten noch einmal sehr genau angucken, ob es da bei irgendeinem Inhaltsstoff Risikoanzeichen gibt", sagt Löwer. Außerdem werde man prüfen ob es nicht in Untersuchungen doch Daten zur Verträglichkeit der Impfung bei schwangeren Frauen gebe. Bei der saisonalen Grippe würden auch Schwangere geimpft. Lediglich bei Lebendimpfstoffen wie gegen Mumps und Röteln, werde grundsätzlich davon abgeraten. Ein weiteres Problem: Auch an Kindern sind die Impfstoffe bisher nicht getestet worden. "Da sind jetzt aber Studien unterwegs", sagt Löwer, räumt aber ein, die würden wohl nicht abgeschlossen sein, wenn der Impfstoff zur Verfügung steht. "Da muss man sehen, ob Kinder dann erst einmal nicht geimpft werden", sagt er.
Bei einer Schnellzulassung des Impfstoffes müssen ohnehin Risiken gegen Nebenwirkungen abgewogen werden, wie es in der aktuellen Ausgabe des britischen Fachblattes "The Lancet" heißt. Bis jetzt verläuft die Schweinegrippe in den meisten Fällen noch mild. Ein Killervirus ist der H1N1-Erreger nicht. Ob eine Massenimpfung mit ihren potentiellen Gefahren unter diesen Umständen gerechtfertigt wäre, ist zumindest fraglich.
Aber auch wer geimpft ist, der genießt keinen hundertprozentigen Schutz. So heißt es in den öffentlichen Beurteilungsberichten der EMEA für Celvapan etwa, in den Tests hätten 73 Prozent der Probanden - 21 Tage nachdem ihnen die zweite Dosis des Impfstoffes gespritzt wurde - eine Konzentration von Antikörpern gehabt, die sie gegen das Virus schützen würden. Ähnliches gilt für die anderen Impfstoffe. Nach neueren Daten handele es sich um bis zu 90 Prozent der Geimpften, sagt Löwer. Aber auch dann wäre jeder Zehnte nach der Impfung nicht vor der Schweinegrippe geschützt. "Der Schutz gegen Infektionen ist immer ein Bündel von Maßnahmen", sagt Löwer daher. "Nur weil man geimpft ist, sollte man keinesfalls aufhören vorsichtig zu sein und sich weiterhin häufig die Hände zu waschen."