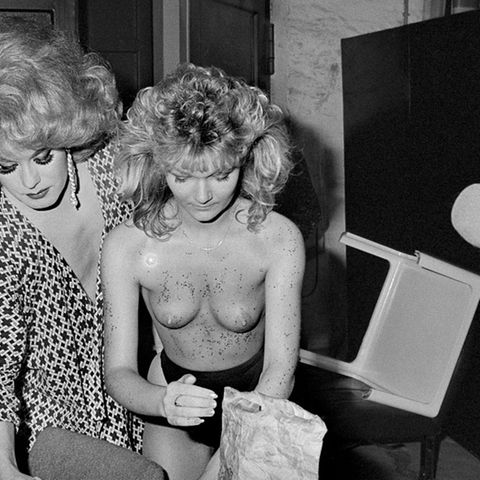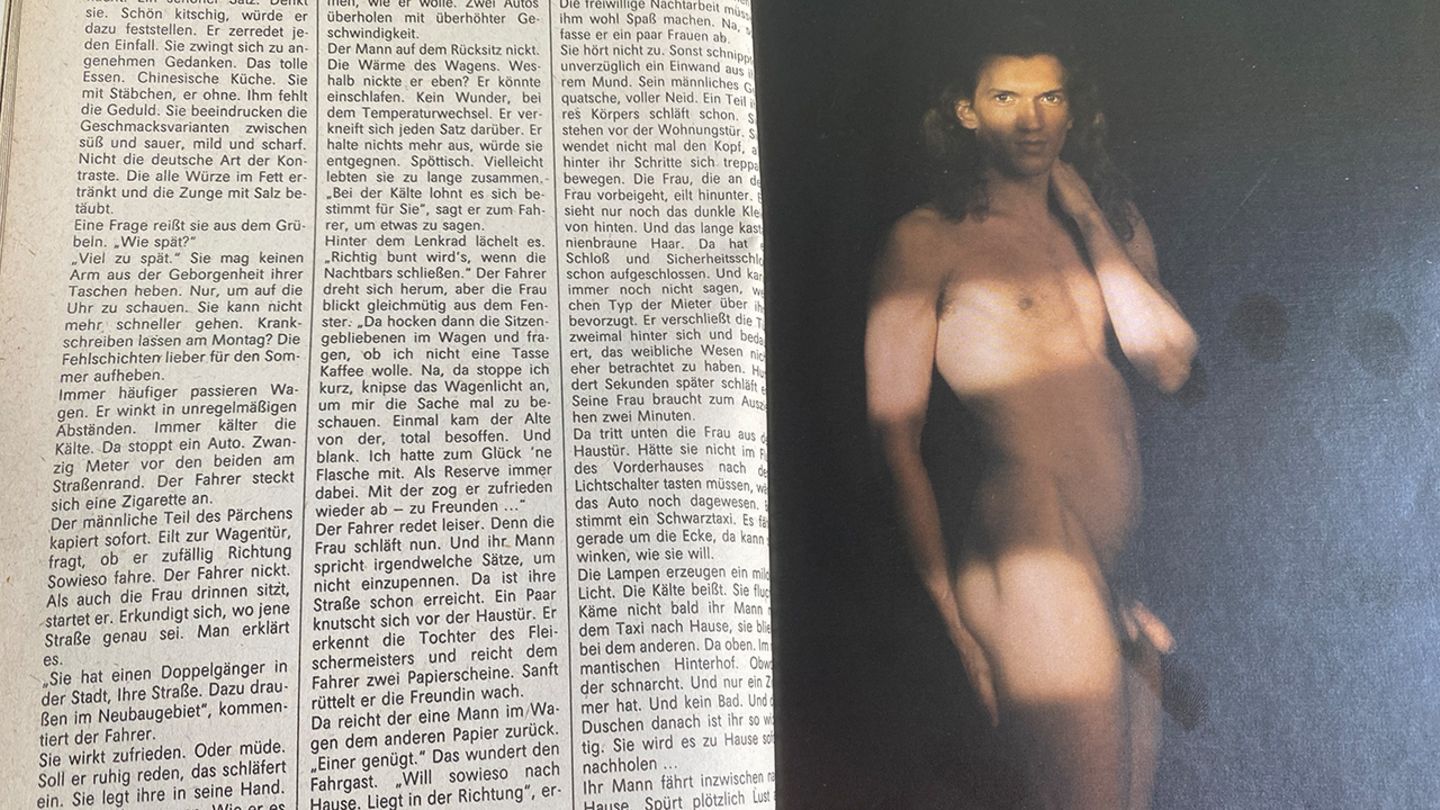Wenn ich westdeutsche Feministinnen heute sprechen höre, dann habe ich manchmal ein mulmiges Gefühl. Das war zum Beispiel so, als Maria Furtwängler in einem Pressegespräch in Berlin beklagte, dass wir in Deutschland "zu wenig Bilder von fähigen Frauen im Kopf haben". Die Worte hören sich für mich an, als kämen sie aus einer anderen Zeit. Kompetente Frauen? Die begleiten mich seit meiner Kindheit ständig.
Die Heldinnen meiner Mädchenjahre waren stark. Meine Freundinnen und ich verkleideten uns als Spice Girls, weil wir die Musik und Videos der britischen Band liebten. Genauso sprang ich durch unser Wohnzimmer und sang laut zur röhrenden Stimme der "Silly"-Sängerin Tamara Danz: "Hurensöhne wissen nicht, was Liebe ist. Hurensöhne wissen, wie man Liebe macht." Und gleich mehrmals las ich Christa Wolfs Roman über die Königstochter Medea – eine Frau, die den Tod ihres Bruders rächte und ihre Heimat verließ, um ihrem unzerstörbaren Sinn für Gerechtigkeit und Wahrheit zu folgen.
Mehr noch prägten natürlich die realen Frauen in meinem Leben mein Bild von weiblicher Kompetenz: Da ist meine Mutter, die Ende der 70er Jahre Werkstofftechnik studierte, später an einem Technologiezentrum arbeitete und heute einen Bildungsgang in einem Berufskolleg leitet. Oder meine Tante: 1989 machte sie als erste Frau den Meister des Elektroinstallateur-Handwerks im damaligen Karl-Marx-Stadt. Nach der Wende leitete sie den Bereich Großküchen in einem Elektroinstallationsbetrieb und plante und baute Großküchen in ganz Deutschland. Da sind auch meine Großmütter: die eine war gelernte Ingenieurin, die andere Lehrerin für Sonderpädagogik. Meine Vorbilder als junge Frau waren Technikerinnen und Unternehmerinnen: Dass es Frauen gibt, die sich nur um den Haushalt kümmern, war mir lange fremd.

Nur Hausfrau zu sein – das Konzept gibt es für mich nicht
So geht es auch meiner Kollegin Sarah, 31. "Dass es so etwas wie Hausfrauen oder Mütter in Teilzeit gibt, ist mir erst klar geworden, als ich nach der Schule ein Au-Pair-Jahr in den USA gemacht habe und mir dort Freunde aus Westdeutschland erzählt haben, wie sie aufgewachsen sind." Und auch meine Freundin Katharine, 37, gelernte Schreinerin und heute Studienrätin, erinnert sich: "Für mich waren arbeitende Frauen immer normal. Das Konzept davon, nur Hausfrau zu sein, gab es nicht. Als ich in der Grundschule war, war meine Mama arbeiten und sie hat mir immer mitgegeben: ‚Guck, dass du auf eigenen Beinen stehst.‘"
Katharine, Sarah und ich haben eins gemeinsam: Wir haben Eltern, die im Osten sozialisiert wurden. Katherine in Dresden, Sarah in Leipzig und ich in Chemnitz. Und so wie uns dreien, geht es den meisten jungen Menschen mit Ost-Hintergrund. Dass Frauen nicht für ihren Lebensunterhalt aufkommen, dass der Mann der alleinige Versorger der Familie ist – das sind Konzepte, die wir nur aus amerikanischen Fernsehserien oder eben dem Leben von anderen kennen.
Auch wenn Hausfrauen ohne Beruf heute Ausnahmen sind: Im Westen arbeitet nach wie vor die Hälfte der Frauen in Teilzeit, im Osten sind es nur 34 Prozent. Das Kinderbetreuungssystem ist hier breiter aufgestellt und mehr Eltern nehmen es ganztags in Anspruch. Dass man nicht arbeitet, ist für die meisten Ost-Frauen keine Option. Zu DDR-Zeiten war Arbeitslosigkeit mit einem Stigma belegt und galt als "asozial”.

Frauen als Verlierer – wieso?
Das Versorgermodell im Westen und die emanzipierte Frau im Osten: Dieser Unterschied hatte eine Auswirkung auf alle Bereiche des Lebens, der uns spätere Generationen noch beeinflusst, glaube ich. Wie ich Beziehung lebe, ist von meinen Eltern geprägt. Partnerschaft auf Augenhöhe, das ist für mich nur dann möglich, wenn jeder für sich selbst sorgen kann – finanziell und auch emotional. "Für Papa und mich war es wichtig, dass sich jeder selbst verwirklichen kann", erzählt mir meine Mutter. Beide hätten sich immer wieder ihre Freiräume gelassen. Mein Vater fuhr auf Studienfahrt nach Taschkent, meine Mutter trampte einige Monate später mit einer Freundin nach Ungarn. Sie machte Studienaufenthalte in Leipzig, er forschte in Polen. Um uns Kinder kümmerte sich in diesen Zeiten der jeweils andere.
Als der Job meiner Mutter nach der Wende zu wackeln drohte und ihr im Westen eine Stelle als Lehrerin in einer Fachschule in Aussicht gestellt wurde, blieben mein Bruder und ich bei unserem Vater im Osten. Als sie sich nach einem Jahr entschied, im neuen Job zu bleiben, zogen wir hinterher. Gerade in der Zeit der Instabilität Anfang der 90er Jahre zeigte sich, wie gleichberechtigt meine Eltern ihren Weg gehen konnten – auch weil jeder sein Einkommen hatte.
In dieser Lebenswirklichkeit tauchten für mich feministische Fragen eigentlich nie auf: Mir kam es nicht in den Sinn, dass meine Mutter oder auch ich weniger Freiheiten hätten, als mein Vater oder mein Bruder. Deshalb wundere ich mich auch heute oft bei Debatten, in denen Frauen als Verlierer dargestellt werden.
Statt Frauenquote besser eine Ostquote?
Auf das Thema "Quotenfrau”, zum Beispiel, blicke ich anders als viele meiner Kollegen in Hamburg. Es gäbe zu wenige Frauen in Führungspositionen, so die These der Befürworter. Bundesweit sind Frauen in Führung deutlich unterrepräsentiert – setzt man die Ostbrille auf, verändert sich aber das Bild. Ein Forschungsprojekt der Universität Leipzig 2019 zeigt: Ostdeutsche Frauen überholen vielerorts in der Arbeitswelt nicht nur die westdeutschen Frauen, sondern auch die ostdeutschen Männer. Von den Richtern auf Länderebene etwa waren im Osten 48 Prozent Frauen, im Westen nur 37 Prozent. Von den Bundesministern, die aus Ostdeutschland kommen, waren 71 Prozent weiblich, unter den Westdeutschen waren es nur 27 Prozent. Im Vorstand von deutschen Dax-Unternehmen gab es nur vier Ostdeutsche – drei davon, Sie ahnen es schon, waren weiblich. Irgendetwas müssen all diese Frauen richtig gemacht haben. Da Ostdeutsche insgesamt in den Führungsetagen unterrepräsentiert sind, würde eine Ost-Quote mehr verändern als eine Frauenquote – denn die weibliche Besetzung wäre dann ganz automatisch mit dabei.
Wo ostdeutsche Frauen mit ihren Lebensentwürfen nach der Wende auf ihre westdeutschen Schwestern trafen, brachten sie einiges in Bewegung. So wie meine Mama auch, bauten sich viele Frauen in den neuen "alten Bundesländern" ein Leben auf. "Als ich nach Solingen kam, sagt mir ein westdeutscher Verwandter: Beruf und zwei Kinder? Das schaffst du niemals", erzählt sie mir. Damals habe sie sich über diese Aussage nur gewundert. Ja, es gab weniger Betreuungsangebote als in der alten Heimat. Aber sie fand eine Kita für meinen Bruder und einen Hortplatz für mich.
Eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung sagt: Sobald zehn Prozent der Frauen in einem westdeutschen Unternehmen aus dem Osten stammten, kehrten auch die westdeutschen Kolleginnen nach der Geburt ihrer Kinder schneller an ihren Arbeitsplatz zurück. So importierte der Westen seit den 1990ern nicht nur viele weibliche Fachkräfte, sondern gleichzeitig ostdeutsche Emanzipation.
Auch wenn Andersdenkende in Firmen die Kultur verändern können, halte ich von Quoten als politisches Werkzeug grundsätzlich nicht viel. Wenn ich andere ostdeutsche Frauen darauf anspreche, merke ich, dass es den meisten von ihnen ähnlich geht. Ilona, die als Ingenieurin in einem Kraftwerk arbeitet, findet, dass Stellen nach Leistung und nicht nach der Geschlechtszugehörigkeit vergeben werden sollten. Heike, 57, aus Berlin fragt sich, ob es die Lebenswirklichkeit einer alleinerziehenden Kassiererin wirklich ändert, wenn es mehr Frauen in den DAX-Vorständen gibt. "Mir macht die zunehmende Polarisierung in Deutschland mehr Sorge als die Anzahl von Frauen in Aufsichtsräten." Eine Quotenfrau zu sein, kann sich keine von ihnen vorstellen. Einige Frauen können der Quote auch etwas Positives abgewinnen: "Wenn Unternehmen dazu gezwungen werden, Frauen bewusst zu fördern, damit genug Frauen an der Spitze ankommen – vielleicht verändert sich dadurch etwas", sagt Kerstin, die ursprünglich von einem Dorf an der Ostsee kommt und heute in Hamburg lebt.
Als ich mit meiner Oma über Quoten spreche, erzählt sie mir ihre eigene Geschichte. Die liegt heute fast 70 Jahre zurück im Jahr 1954 – eine Zeit, in der die DDR kräftig am Sozialismus baute. Der Zugang zu den Fachhochschulen wurde mit Quoten geregelt. Das hätte sie damals fast den Studienplatz gekostet. "75 Prozent der Schüler mussten aus dem Arbeitermilieu kommen. Dein Urgroßvater war Studienrat, das verschlechterte meine Chancen auf ein Studium. Meine Leistungen in der Vorprüfung zählten nicht." Ihren Studienplatz bekam sie doch: Einer der Bewerber aus der Arbeiterschicht war in den Westen geflohen. Sie durfte auf seinen Platz vorrücken. Schließlich brauchte man jeden, um das neue System aufzubauen – die Emanzipation in der DDR war eine wirtschaftliche Notwendigkeit.
Nacktheit im Alltag war ganz normal
Ein anderer Punkt, der mich auf Abstand zu einigen Feministinnen bringt: die Forderung nach einem Prostitutionsverbot. Alice Schwarzer meint für alle Frauen zu sprechen, wenn sie sagt, Sexarbeit könne nie freiwillig sein – deshalb müsse man den Kauf von Sex grundsätzlich verbieten. Während meiner Arbeit als Journalistin habe ich viele Frauen kennengelernt, die erfolgreich und gerne sexuelle Dienstleistungen anbieten. Ich frage mich, wie Schwarzer und ihre Mitstreiterinnen, es sich anmaßen können, diesen Frauen ihre Selbstbestimmtheit abzusprechen. In ihrem Denken scheint eine Prostituierte nur als Objekt für den Mann zu existieren – eine Ansicht, die meiner Meinung nach zutiefst patriarchal ist.
Dass Frauen über ihre eigene Sexualität selbst entscheiden, war für Frauen in der DDR rechtlich entspannter. Abtreibungen wurden nicht strafrechtlich verfolgt. Nacktheit gehörte zum Alltag – die FKK-Kultur ist dafür nur ein Beispiel. Ich erinnere mich zum Beispiel, dass auf der Toilette im Haus meiner Großmutter immer die neuen Ausgaben der ostdeutschen Zeitschrift "Das Magazin" lagen. Im Jahr vor der Wende hatte das Heft eine Auflage von etwa 500.000 Stück. Neben gesellschaftlichen Themen waren hier in jedem Heft auch Aktfotografien abgebildet – nicht als reißerisches Cover, sondern fast beiläufig zwischen literarischen Erzählungen oder einer Reportage. Als Mädchen schaute ich mir die nackten Menschen darin an – die nackten Körper waren spannend, aber auch nichts Ungewöhnliches für mich. Meine Oma erklärte mir anhand der Fotos, wie sich mein Körper als erwachsene Frau verändern würde. Heute würden diese Bilder auf Instagram und in anderen sozialen Medien zensiert, weil sie sexistisch seien.
Auch die DDR war ein patriarchales System
Auch wenn die Frauen in der DDR ihr eigenes Geld verdienten, über ihren Körper bestimmen konnten, und entsprechend selbstbewusst sein konnten, war das System patriarchal. Im ZK gab es nur wenige Frauen. Männer entschieden, wie Frauen in der DDR emanzipiert werden sollten. Gegen diesen Paternalismus lehnten sich in 80ern bereits einige Frauengruppen auf.
Das weiß Susanne Scharff, die 1990 die Frauenbibliothek MONAliesA in Leipzig gründete. Vor dem Mauerfall habe sie bereits im Kleinen versucht Dinge zu ändern. Die Wende habe sie dann endgültig wachgerüttelt, nachdem sie in Wien die feministische Szene kennenlernte. In Leipzig organisierte sie Diskussionsabende zu Themen wie Gewalt von und gegen Frauen, weibliche Freiheit, Bisexualität, Essstörungen oder Frauen auf dem Arbeitsmarkt – sie hatten großen Zulauf. "Es war eine Befreiung für mich, dass ich Türen aufmachen konnte, die ich vorher nicht kannte." 1997 wurde Scharff für ihre Arbeit auf der Frankfurter Buchmesse als "BücherFrau des Jahres" ausgezeichnet.
Emanzipation heißt laut Duden nicht nur Gleichstellung. Es bedeutet auch: die Befreiung aus dem Zustand der Abhängigkeit. Beim Gespräch über Feminismus in Ostdeutschland frage ich Susanne Scharff: Wie emanzipiert sind eigentlich die Männer? Scharff erzählt mir, dass sich in den 90er Jahren auch Männergruppen gegründet hätten. "Die hatten aber nicht die gleiche Wucht."
Wie emanzipiert sind die Männer?
Während das DDR-Regime mit der Frauen-Emanzipation von oben und der Grundversorgung für Kinder, die Frauen in den Beruf brachte, schienen die ostdeutschen Männer eher leer auszugehen. Mit dem Untergang des Regimes verloren sie die ihnen vom System zugesprochene Rolle des Sozialisten. Die Eigenständigkeit der Männer im Haushalt und der Familie wurden vom Zentralkomitee kaum propagiert – und auch auf die emotionale Kompetenz des einzelnen legte der Staat wenig wert. Dass Männer auch als Väter Verantwortung übernehmen, ist etwas, dass sich erst nach der Wende in West und Ost langsam entwickelt – dank politischer Anreize wie dem Elterngeld und der Elternzeit und weil immer mehr Väter diese Rolle wollen.
Heute sind die Frauen, mit denen ich als Mädchen die Spice Girls nachahmte, Ärztinnen, Controllerinnen und Lehrerinnen – und alle von ihnen haben bald Kinder. Mein Mann und ich arbeiten beide Vollzeit. Die Hausarbeit teilen wir uns – momentan fast gerecht: er 60 Prozent, ich 40 Prozent. (Er ist aber auch ein Pedant ;).)
An der Wand in unserem Schlafzimmer hängen die Bilder neuer Heldinnen. Die niederländisch-amerikanische Politikwissenschaftlerin Ayaan Hirsi Ali erinnert mich daran, dass es Mut braucht, um unbequeme Wahrheiten ans Licht zu bringen. Die norwegisch-britische Filmemacherin Deeyah Khan steht für mich für die Fähigkeit zuzuhören, auch wenn das Zuhören schmerzhaft ist. Beide bringen durch ihren Blick neue wichtige Perspektiven in unsere Welt – auch als Frauenrechtlerinnen, aber vor allem, indem sie durch ihre Arbeit provozieren und neue Anstöße liefern.