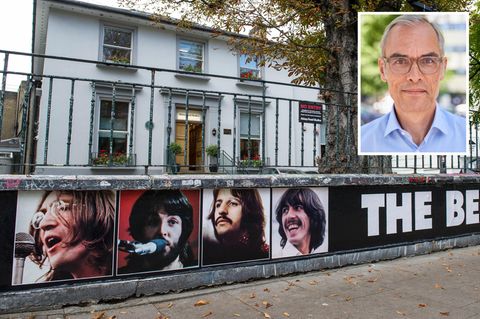Ein Würmchen krümmt sich im allerersten Bild des Films, nackt, blass und wehrlos. Auf die Idee, eines der größten Epen der Kinogeschichte ausgerechnet mit der geringsten aller Kreaturen einsetzen zu lassen, kann nur einer verfallen, der sich als Schöpfer einer ganzen Welt begreift, als Herrscher über Himmel und Erde. Mittelerde, in diesem Fall.
Wenn der dritte und letzte Teil der "Herr der Ringe"-Trilogie am 17. Dezember weltweit anläuft - allein in Deutschland mit etwa 1000 Kopien -, dann soll auch der letzte Zuschauer einsehen, dass er es nicht mit einem Film unter Filmen zu tun hat, sondern mit einer gewaltigen Schöpfungsgeschichte - sein Eintrittsgeld ist die Opfergabe, durch die er einer beinahe religiösen Erfahrung teilhaftig wird.
Nur ein Ketzer würde darum erwähnen, dass der rauschebärtige, schmerbäuchige Gottvater dieser Parallelwelt, unter dem irdischen Namen Peter Jackson bekannt, nicht sieben Tage, sondern sieben Jahre für seinen Schaffensakt gebraucht hat, dazu Tausende von Erfüllungsgehilfen und die Unterstützung der neuesten Computertechnologie. Und der 42-Jährige musste auch nicht mit einem wüsten und leeren Planeten anfangen, weil es schon einen 1300 Seiten langen Bauplan gab, vor fast einem halben Jahrhundert verfasst von einem schrulligen englischen Pfeifenraucher namens J.R.R. Tolkien, der von einer weltumspannenden Gefolgschaft ebenfalls seit langem als Allmächtiger verehrt wird. Zu dessen Rechten wird Jackson mit der Vollendung seiner Filmversion nun auffahren - jedenfalls für die Jünger. Was den "Herrn der Ringe" angeht, so spaltet sich, wie bei jeder Glaubensfrage, die Menschheit nun einmal in Fromme und Heiden.
"Die Rückkehr des Königs"
übertrifft, das verlangt zwangsläufig die Dramaturgie einer solchen großen Erzählung, das Vorangegangene an schierem Spektakel. In fantastischer Prachtentfaltung zelebriert der Film das nie zuvor Gesehene, er soll die Zuschauer mitreißen in eine fremde, abenteuerliche, ebenso furchterregende wie wundersame Realität. Da tummelt sich eine gigantische Spinne in einer finsteren Bergspalte, da wälzt sich ein Heer von Untoten, durchsichtig wie Röntgenbilder, über die Feinde hinweg, und ein Trupp von Riesenelefanten zerstampft alles, was sich ihm in den Weg stellt.
Für normalsterbliche Verhältnisse, das werden auch Ketzer zugestehen, legt Jackson ein gewaltiges Talent zum Weltenbauen an den Tag. Wenn, ja, wenn da nicht die Geschichte wäre, für die diese ganze Parallelerde erst geschaffen wurde - jene pathetische, aus allen erdenklichen Mythen zusammengefügte und mit großtuerischem Ewigkeitsanspruch überladene Saga von Freundschaft, Tapferkeit, Bestimmung, Macht und Versuchung. An die muss man einfach glauben, um sie zu ertragen.
Begonnen hatte alles, so will es "Der Herr der Ringe", mit dem Schmieden eines Rings, in dem sich die ganze Kraft des Bösen bündelt. Der ging seinem dämonischen Herrn verloren und gammelte einige Jahrtausende vor sich hin, bis er in Teil eins, "Die Gefährten", in den Besitz eines Hobbits namens Frodo (Elijah Wood) geriet. Ausgerechnet dieser Harmlosling muss sich nun aufmachen, um das heimtückische Schmuckstück zu entsorgen - und das kann nur geschehen, wo es einst geschmiedet wurde: im feurigen Schlund der Festung seines eigentlichen Herrn.
Frodo und seine acht Gefährten verschiedener Gattungen machen sich auf, nach allerhand männerbündlerischem Tamtam, darunter der Königssohn Aragorn (Viggo Mortensen), der Elbenprinz Legolas (Orlando Bloom) und der Zwerg Gimli (John Rhys-Davies). Im zweiten Teil, "Die zwei Türme", wird diese Abenteuerreisegruppe in alle Winkel Mittelerdes versprengt, und während Frodo, treu unterstützt von einem Hobbit namens Sam (Sean Astin), vor allem in Sumpf und Gebirge gegen die düstere Verlockung des Rings zu kämpfen hat, schlagen die anderen so manche Schlacht im Dienste des Guten.
In "Die Rückkehr des Königs" nun muss eine weitere Bergfeste vor dem Ansturm der Finsterlinge verteidigt werden, und ein zunehmend umnachteter Frodo schleppt sich mit Sams Hilfe Schritt für Schritt der Erfüllung seines Auftrags entgegen. Dann endlich erwartet uns - was sonst? - das letzte Gefecht zwischen der Allianz der Willigen und den Mächten der Dunkelheit. Mit dem Fanal "Für Frodo!" führt Aragorn seine Mannen in den nahezu sicheren Untergang.
Und weil das alles so erhebend und so lang war, gönnt Jackson seinem Film nicht nur ein Ende, sondern geschlagene sechs: Ein Fall von Schöpferwahn, ganz offensichtlich kann sich der Mann nicht von seinen Schützlingen trennen. Beim allfälligen Glück am Ende, so könnte ein Ketzer bemerken, geht dem ehemaligen Horrorfilmer Jackson die göttliche Puste aus - die Idyllen im Auenland und Bruchtal könnten auch vom Titelblatt eines Burgfräulein-Romans stammen.
Doch was macht das schon
bei einer Schöpfungsgeschichte, die sich längst zur Abschöpfungsgeschichte gewandelt hat? Und zwar einer, die weit über die beeindruckenden Kassenzahlen von mehr als 1,7 Milliarden Dollar für die beiden ersten Teile hinausgeht. Wie kaum ein anderes Werk der Filmgeschichte hat die Trilogie ökonomisch auf alle ausgestrahlt, die mit ihr in Berührung kamen - vielleicht wirkt hier doch, ganz weltlich-kapitalistisch, der Zauber des Rings?
Neuseeland erlebt eine touristische Hausse, seit sich der abgelegene Inselstaat als "Heimat von Mittelerde" preisen kann. Mehr als 90 Prozent aller ausländischen Besucher, so hat eine Umfrage erbracht, kennen die Verfilmung, und ein Zehntel von ihnen gab an, der "Herr der Ringe" sei einer ihrer Reisegründe gewesen. Allein die Hauptstadt Wellington rechnet damit, dass im Laufe des nächsten Jahrzehnts rund 160 Millionen Dollar aus der "Frodo-Ökonomie" auf sie abfallen wird.
Auch wortkarge Farmer in abgelegenen neuseeländischen Tälern haben gelernt, dass Hobbits einträglicher als Schafe sein können. Mehr als ein Dutzend einheimischer Veranstalter bieten unterschiedlichsten touristischen Ringe-Pietz an. Auch eine deutsche Firma organisiert ab 3885 Euro Trips in die "irdische Heimat" der Tolkienschen Helden. Selbst die winzige Filmindustrie Neuseelands nennt sich nun keck "Wellywood" und wirft sich in den Konkurrenzkampf mit anderen kostengünstigen Drehländern wie Kanada und Tschechien. Ein Vorteil: Fast alle gewünschten Landschaftsformen stehen auf engem Raum zur Auswahl, garantiert unverbaut und idyllisch, jedenfalls noch. Gerade erst hat der neuseeländische Mount Taranaki im Tom-Cruise-Film "Der letzte Samurai" den japanischen Fuji gedoubelt.
Aus No-Name-Darstellern, die Jackson verpflichtete, sind trotz unvorteilhafter Rollenausstaffierung Filmstars geworden: Orlando Bloom etwa, als spitzohriger Elbenrecke zielgenau mit Pfeil und Bogen, hat sich in die Leonardo-DiCaprio-Umlaufbahn geschossen: "Debloom me!", forderten ihn bei der Welturaufführung vorige Woche in Wellington jugendliche weibliche Fans auf, eine elegante Abwandlung von "Entjungfere mich".
Jackson selbst hat vor kurzem den höchsten Betrag ausgehandelt, den Hollywood je für einen Filmemacher herausgerückt hat: 20 Millionen Dollar plus 20 Prozent der Einspielergebnisse erhält er für die Neuverfilmung von "King Kong", die er sich als Nächstes (natürlich in Neuseeland) vornehmen will.
Auch die Geschichten, die sich um die Entstehung der insgesamt neundreiviertelstündigen Kinotrilogie ranken, haben inzwischen eine Aura der göttlichen Vorsehung angenommen - ganz so, als könne eine Verfilmung ihrem Stoff nur angemessen sein, wenn sie vom gleichen Schöpfungsgeist umwoben wird. "Schicksal" sei es gewesen, sagt Jackson, dass der fast schon gescheiterte Plan, den Roman zu verfilmen, dank der damals drittrangigen Hollywoodklitsche New Line Cinema 1999 doch noch verwirklicht wurde. Und "Irrsinn" seien dann die Dreharbeiten gewesen, bei denen - ein nie zuvor gewagter Coup - in 15 Monaten für rund 310 Millionen Dollar alle drei Filme auf einmal entstanden.
Nur Gigantismus
konnte der Größe der Aufgabe gerecht werden, und so wurden immer neue Zahlen in Umlauf gebracht: 26.000 Statisten kamen zum Einsatz, 48.000 Schwerter, 900 Rüstungen und 1600 Hobbit-Füße wurden in feinster Handarbeit hergestellt, und bei einem einzigen Frühstück der Crew kamen 1460 Eier auf den Tisch. So wurden die Fans, die anfangs ganz und gar nicht von der Idee einer Verfilmung begeistert waren, von der Einzigartigkeit des Vorhabens überzeugt.
Denn auch das gehört zur Schöpfungsgeschichte des Films: dass die "Ringe"-Gefolgschaft erst keine Götter neben ihrem Pfeifenraucher dulden wollte und die Trilogie darum gegen jede Wahrscheinlichkeit und Vernunft entstand, als Va-Banque-Nummer von Besessenen, die nicht nur einen, sondern gleich drei 100-Millionen-Flops riskierten. Dass Peter Jackson nur darum als Auserwählter anerkannt wurde, weil er sich demütig als Fan unter Fans zu erkennen gab, der beim Dreh stets die heilige Schrift auf dem Schoß balancierte.
Selbst die Darsteller trugen ihren Teil zur Überhöhung des Unternehmens bei, indem sie den Endlosdreh zu einer lebensprägenden Erfahrung verklärten - ganz ähnlich derjenigen, als die viele Leser das Buch selbst empfunden haben. Als Nachweis ihrer Loyalität ließen sich Elijah Wood und andere in der von Tolkien erfundenen Sprache Elbisch das Schriftzeichen für "9" tätowieren, das sie als Mitglied der Ring-Bruderschaft ausweist.
Nur ein Ketzer kann daher noch kleinlich darauf hinweisen, dass Jacksons Schöpfung ihren Erfolg vielleicht auch der Tatsache verdankt, dass sie verdammt gut in eine Zeit passt, in der ein Weltenretter auf der Leinwand den nächsten jagt. Denn Frodo ist ein Bruder im Geiste des Zauberschülers Harry ebenso wie des Maschinenstürmers Neo aus der "Matrix": Kultstatus erreichen zurzeit Geschichten mit jungenhaften Erlösern, die trotz ihrer Schwächen gut sind und von ihrer Auserwähltheit erst überzeugt werden müssen. Sowohl Frodo als auch Harry und Neo treten gegen eine weitgehend unsichtbare, darum umso gefährlichere Größe an, die mit Gewalt niedergerungen werden muss - nur um, da entspricht das Gesetz der Hollywood-Mehrteiler dem Gesetz der Mythologie, immer neu aufzuerstehen.
Und nur ein Ketzer kann anmerken, dass der "Krieg gegen den Terror" derzeit ein ganz ähnliches manichäisches Weltbild entwirft, geprägt von den Forderungen nach Opferbereitschaft und dem absoluten Glauben an die gute Sache - mit George Bush als fehlbarem, aber tapferem Helden im Kampf gegen den Fundamentalismus. Doch wann hat ein Ketzer je etwas gegen die Gläubigen dieser Welt ausgerichtet?
Susanne Weingarten