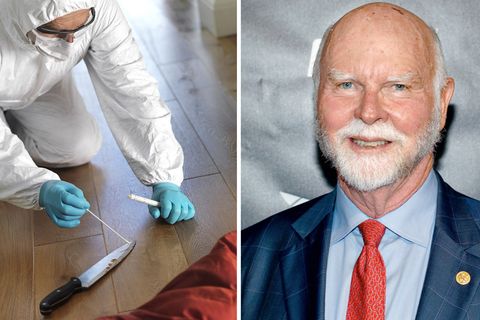Still und friedlich ruhen die drei Trommeln unter den rotblauen Scheinwerfern auf der Bühne. Eine dicke in der Mitte und zwei kleine rechts und links. Plötzlich gleiten Körper herein, die nur als Schemen zu erkennen sind. Wie Wildkatzen tanzen sie mit Trommeln um den Bauch durch das Dämmerlicht, schlagen mit hölzernen Stöcken auf die Trommeln ein. Scheinwerfer tauchen einen Mann in schwarzen Pluderhosen in gelbes Licht. Er lässt eine wuchtige Keule auf die Riesentrommel in der Bühnenmitte herabsausen. TONG! Die Luft zittert. Die Zuschauer applaudieren begeistert.
Wuschelige Locken und viel Charme und Humor
Die Antwort der Trommlergruppe Yamato: ein Kampfschrei aus zehn Kehlen. Und dann wirbeln Arme und Stöcke durch die Luft, schwarze Wuschelhaare peitschen wild um verzerrte Gesichter. Die Trommler tanzen an den Bühnenrand, strecken zwanzig Stöcke empor und senken sie. Doch das erwartete Trommeldonnern ertönt nicht. Kurz bevor ihre Stöcke die Trommeln berühren, halten die Spieler abrupt inne. Die Zuschauer halten den Atem an. Bandleader Takeru Matsushita winkt salopp in die Menge und grinst: "Hello". Die Spannung löst sich auf in Gelächter.
Was ist Taiko?
"Taiko" bedeutet "große Trommel". Der Legende nach wurde das Taikospiel vor 1700 bis 1800 Jahren aus China überliefert. Ursprünglich wurden die Trommeln vor religiösen Zeremonien eingesetzt, um die Götter aufzuwecken - ein Brauch, der heute in japanischen Schreinen und Tempeln von Blechglocken vor dem Altar und dem kurzen Klatschen der Gläubigen vor dem Gebet übernommen wird. Später untermalten Trommeln auch religiöse Rituale. Außerdem wurde mit Taikos die Zeit verkündet und zwischen den Dörfern kommuniziert. Heute werden Taikos vor allem auf den zahlreichen Volksfesten gespielt.
Seit 1993 spielt, trainiert, kocht, isst und wohnt die Trommlergruppe zusammen. Die zehn Mitglieder von Yamato sind ständig auf Achse, geben pro Jahr rund 200 Konzerte, standen schon auf den Bühnen Brasiliens und Mexikos, in Israel und Polen. Hinter dem Erfolg steckt harte Arbeit. Jeden Tag trainieren sie von früh bis spät. Atemübungen und Fitnesstraining sind dabei genauso wichtig wie das Trommelspiel an sich. Die muskulösen Arme und Schultern der Trommler lassen erahnen, wie anstrengend solch ein Auftritt ist.
In der Mitte eines jeden Menschen, im Zentrum seiner Lachens und Weinens stehe das Schlagen des Herzens, sagt der Gründer der Gruppe, Masa Ogawa. Der Klang der Trommel mache "den Klang der Seele, die Stimme des Herzens" hör- und fühlbar. Dabei ist die Stille - das "ma" - zwischen den Schlägen genauso wichtig wie der Trommelschlag selbst. Nur wer auch die Stille hört, kann die Taiko richtig spielen.
Zimbel-Pop und Ton-Pingpong
Taikos gibt es in vielen verschiedenen Größen und Formen - die größte wiegt 400 Kilogramm. Das Publikum lernt sie gleich im zweiten Stück alle kennen. Denn da entbrennt ein Wettkampf zwischen zwei Trommlern, die sich gegenseitig mit immer größeren Taikos überbieten. Schließlich tanzt ein dritter auf die Bühne, der kleine Bronzezimbeln aneinanderschlägt. Die beiden Trommler lassen ihre Trommeln links liegen und das Trio schüttelt locker ein Zimbel-Popkonzert aus den Ärmeln und spielt mit Tönen Pingpong.
Yamato auf Europatour
15. bis 27. August
Hamburg, Laeiszhalle
29. August bis 2. September
Zürich, Kongreßhaus
12. bis 17. September
Baden-Baden, Festspielhaus
19. bis 24. September
Bremen, Musical Theater
27. bis 30. September
Genf, Grand Casino
"Entertainment steht für uns an erster Stelle", sagt Matsushita, der vor zehn Jahren seine erste Taiko geschlagen hat. "Wir wollen dabei nicht nur für ein Publikum spielen, das uns brav zuhört, sondern wir wollen mit den Zuschauern gemeinsam unser Konzert gestalten." Das gelingt: Für die charmanten Trommler klatschen die Zuschauer im Takt von Matsushitas Taiko und werfen ihre Arme in die Luft.
In Europa und den USA wird Taiko immer bekannter. Japanische Gruppen wie Kodô, Za Ondekoza und Yamato trommeln europaweit in ausverkauften Konzerthallen, und Taiko-Fans im Westen ahmen sie eifrig nach. In den USA und Kanada gibt es bereits rund 1000 einheimische Taiko-Gruppen.
Knarrend zitterndes Wehklagen
Doch Taiko war nicht immer so populär wie heute. Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel das Taikospiel wie so viele andere Traditionen dem Modernisierungswahn der aufstrebenden Wirtschaftsnation zum Opfer. Erst in den Siebzigern wurden die japanischen Trommeln neu entdeckt - als Musikinstrument. Die Idee von Taiko-Bands, die auf Bühnen Massen unterhalten, wird allerdings von vielen Traditionalisten in Japan abgelehnt.
Dabei ist die Musik von Yamato keineswegs nur modern. Wenn die fünf Frauen der Gruppe das knarrend zitternde Wehklagen der Shamisen, der japanischen Gitarre, erklingen lassen, möchte man sich einen Samurai in Strohsandalen vorstellen, der müde über eine weite, windige Ebene läuft. Und wenn sie die Miya-Daiko, die Riesentrommel, mit geschmeidig kraftvollen Bewegungen vibrieren lassen, sieht man ein Heer vor sich, das von dem tiefdunklen Rhythmus zur Schlacht getrieben wird.
Blitzartig wie Regentropfen
Oder man hört das Grollen eines aufziehenden Gewitters, denn die Show von Yamato steht unter dem Motto "Kaminari" - Donner und Blitz. Blitzartig prasseln die Arme der Trommler auf die Taikos nieder, wie Regentropfen auf eine Dachrinne. Dann wieder wogt der Rhythmus von einer Trommel zur nächsten wie Windböen vor einem Unwetter. Eine Bambusflöte erklingt, süß und lieblich wie eine laue Frühlingsnacht - bis plötzlich der Donner über das Publikum hereinbricht. Dämonisch von unten angestrahlt wirbeln die Trommler vor ihren Taikos wie Gewittergeister.
Mit Standing Ovations verabschieden die Zuschauer die Trommler von der Bühne. Was genau sie in den Bann gezogen hat, können viele gar nicht beschreiben. "Ich weiß nicht, ob es Musik, Akrobatik oder Theater war. Aber es war auf jeden Fall faszinierend", sagt eine Besucherin.