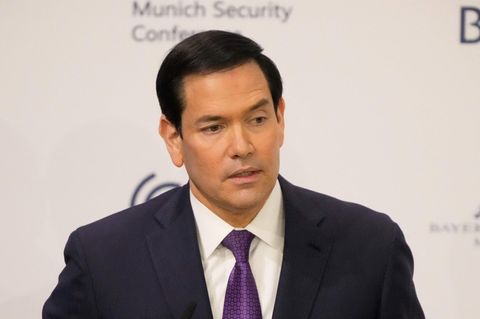Einige hatten ihr Urteil über die Vertriebenenausstellung "Erzwungene Wege - Flucht und Vertreibung im Europa des 20. Jahrhunderts" schon gefällt, bevor sie eröffnet war. Dazu zählte der stellvertretende polnische Kulturminister Krzysztof Olendzki. Die Gründe der Vertreibung würden nicht klar gezeigt, monierte er. "Die Ausstellung schiebt außerdem die Verantwortung für die vom deutschen Staat während des Zweiten Weltkrieges begangenen Verbrechen ab." Wie Olendzki hatten auch die etwa ein Dutzend Demonstranten, die sich am Donnerstag vor dem Berliner Kronprinzenpalais versammelten, die Ausstellung noch nicht gesehen. Eine junge Frau sagte, sie habe die Medienberichterstattung darüber verfolgt, das reiche ihr.
"Geschichtsrevisionismus angreifen statt ausstellen" war auf einem Plakat der Demonstranten zu lesen. Alleine die Tatsache, dass eine Ausstellung die Vertreibungen im Europa des 20. Jahrhunderts nebeneinander präsentiert, reicht aus, um die Gemüter zu erhitzen. Und dass die Präsidentin des Bundes der Vertriebenen, Erika Steinbach, als Vorsitzende der Stiftung Zentrum gegen Vertreibungen für das Projekt verantwortlich ist, lässt viele Kritiker von vornherein an der Ausgewogenheit zweifeln. "Erzwungene Wege" ist nicht nur eine Ausstellung, sondern ein Politikum. Steinbach will mit der Präsentation der 280 Exponate die Tür für ein dauerhaftes Zentrum gegen Vertreibungen in Berlin aufstoßen. Ihre Stiftung verfolgt seit sechs Jahren dieses Ziel. Seitdem sorgt die Zentrumsidee auch für Verstimmungen im deutsch-polnischen Verhältnis.
Europäischer Ansatz
"Erzwungene Wege" zeigt zum ersten Mal, wie sich die Stiftung ein Zentrum gegen Vertreibungen ungefähr vorstellt. Wichtig war Steinbach der europäische Ansatz. Von den etwa 30 Völkern Europas, die im 20. Jahrhundert von Vertreibung betroffen waren, wurden für die Ausstellung aus Platzgründen nur einige ausgewählt. Die Vertreibung der Armenier aus dem Osmanischen Reich 1915/16 zählt ebenso dazu wie das Schicksal der Vertriebenen aus Bosnien-Herzegowina in den 90er Jahren. Auch weniger bekannte Vertreibungsschicksale wie das der finnischen Karelier werden gezeigt.
Ein Kapitel ist der Vertreibung der Juden Europas als "Baustein des Holocaust" gewidmet. Die Ermordung von sechs Millionen Juden ist dagegen kein Thema. Dabei handele es sich um einen "singulären Vorgang", der nicht in eine solche Ausstellung gehöre, sagte Steinbach. Die Ausstellung wird durch lange Textpassagen erläutert, die allerdings nur in Deutsch zu lesen sind - ungewöhnlich für einen europäischen Ansatz. Steinbach begründet das damit, dass der kleinste falsche Schlenker bei der Übersetzung schon zur Katastrophe führen könnte.
300 Kilo schwere Glocke
Die 280 Exponate stammen von 80 Leihgebern aus 14 Nationen. Dazu zählen ein assyrisches Brautkleid, eine Fahne der nach Sibirien verschleppten Polen, eine zyprisch-griechische Ikone oder ein Hutkoffer einer finnisch-karelischen Familie. Größtes Ausstellungsstück ist die 300 Kilogramm schwere Glocke des von einem sowjetischen U-Boot versenkten Flüchtlingsschiffs "Wilhelm Gustloff". Bis zum 29. Oktober wird die Ausstellung in Berlin gezeigt. Steinbach hätte nichts dagegen, wenn sie anschließend in anderen europäischen Städten Station machen würde, etwa in Breslau oder Prag. "Aus meiner Sicht wäre das eine gute Sache", sagt sie. Sie weiß aber auch, dass das Interesse daran in den Nachbarländern äußerst gering ist.
In Polen hat sich die Kritik nach der Ausstellungseröffnung verschärft. "Das ist ein sehr schlimmes, beunruhigendes und trauriges Ereignis", sagte Regierungschef Jaroslaw Kaczynski vor Journalisten am Rande eines Besuches im früheren Nazi-Konzentrationslager Stutthof bei Danzig. Die Ausstellung bringe nichts Gutes für Polen, Deutschland oder Europa insgesamt. Der ehemalige polnische Ministerpräsident und amtierende Warschauer Bürgermeister Kazimierz Marcinkiewicz hat einen für Freitag geplanten Besuch in Warschaus Partnerstadt Berlin kurzfristig abgesagt.
DPA/AP