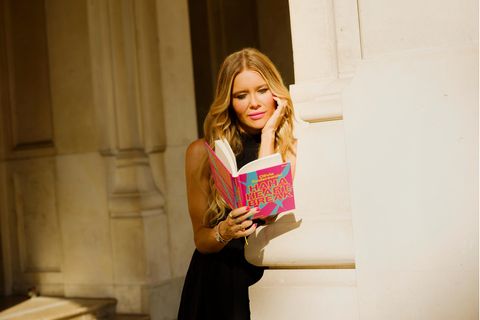Lassen Sie sich gegen die Schweinegrippe impfen, Herr von Hirschhausen?
Ja. Die Grundidee bei allen Infektionskrankheiten ist, dass es sich nicht um ein individuelles, sondern ein Problem von uns allen handelt. Indem ich mich impfe, schütze ich mich selbst. Aber viel wichtiger ist doch, dass ich Leute schütze, die sich nicht schützen können. HIV-Erkrankte, Krebspatienten oder Organtransplantierte zum Beispiel, die gerade ihr Immunsystem unten haben, die dann mit einer an sich nicht schwierigen Infektion plötzlich überfordert sind. Aber auch Kinder, Schwangere. Jeder Gesunde, der geimpft ist, ist einer weniger, der die Erkrankung übertragen kann. Wenn man sich impfen lässt, denkt man nicht nur an sich, sondern solidarisch.
Das ist, ehrlich gesagt, das einzige Argument, das mich bisher überzeugt.
Das ist auch das einzige, das mich überzeugt. Kinderkrankheiten haben auf Grund der Impfungen ihren Schrecken verloren. Das hat dazu geführt, dass gerade naturheilkundlich orientierte Eltern diese Krankheiten nicht mehr ernst nehmen und denken "Mein Kind darf das ruhig alles selbst durchmachen". Aber jedes Jahr sterben Kinder an Masern, jedes Jahr gibt es Hirnhautentzündungen durch solche Virenerkrankungen, Fehlbildungen durch Röteln in der Schwangerschaft, Unfruchtbarkeit etc. – alles komplett unnötig. Es gibt genug Viren, gegen die man nicht impfen kann, an denen wir alle Erfahrungen von Gesundheit und Krankheit machen können. Wenn wir impfen können, sollten wir das auch tun. Das ist einer der größten Durchbrüche in der Geschichte der Medizin. Und das geht in der aktuellen Diskussion gerade ein bisschen verloren.
Sie engagieren sich in Benefiz-Projekten, und sicherlich bekommen Sie jeden Tag neue Anfragen zu solchen. Warum haben Sie die Aids-Gala unterstützt?
Ich unterstütze gerne Projekte, die mit meinem Ur-Anliegen zu tun haben: Nämlich dass Medizin kein Herrschaftswissen ist. Alles, was man über sich, seinen Körper und seine Seele wissen kann, soll allgemeinverständlich und zugänglich sein. Die Geschichte um die Aids-Gala herum ist auch eine Erfolgsgeschichte: Von relativ früh an haben sich Künstler dafür stark gemacht, der Tabuisierung dieser Infektionskrankheit entgegen zu treten. In Zeiten der Schweinegrippe ist das eine sehr aktuelle Geschichte. Wir denken schnell, dass die Medizin uns vor allem schützen und gegen Infektionskrankheiten tatsächlich etwas ausrichten könnte. Natürlich wird intensiv geforscht, aber das Beste ist immer noch die Vorbeugung. Das halte ich auch gerne mit komödiantischen Mitteln im allgemeinen Bewusstsein.
Sie zitieren Oscar Wildes Aphorismus: "Das Leben ist zu wichtig, um es zu ernst zu nehmen": Wie soll man eine Krankheit wie Aids, an deren Ende der Tod steht, nicht ernst nehmen?
An unser aller Lebensende steht der Tod. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Eckart von Hirschhausen
Dr. med. Eckart von Hirschhausen, Jahrgang 1967, ist seit mehr als 15 Jahren als Kabarettist, Autor und Moderator in Deutschland präsent. Sein Bühnenprogramm "Glücksbringer" haben mehr als 500.000 Zuschauer live erlebt. Sein Buch "Die Leber wächst mit ihren Aufgaben" war das erfolgreichste Sachbuch 2008. Der Nachfolger "Glück kommt selten allein" steht seit Erscheinen auf Platz eins der Bestsellerliste. 2008 gründete er die Stiftung Humor hilft Heilen und sammelt Spenden, um das therapeutische Lachen in Medizin und Öffentlichkeit zu fördern und Clowns in Krankenhäuser zu bringen.
Wenn die Zeit sehr kurz ist, ist das nicht witzig.
Nein, aber an der Bilanz ändert sich nichts, und das ist auch die eigentliche Quelle von Komik. Diese Grundabsurdität des menschlichen Daseins: Wir kommen aus Staub, wir werden zu Staub. Deshalb meinen die meisten Menschen, es müsse im Leben darum gehen, viel Staub aufzuwirbeln. Gesundheitsaufklärung hat ein großes Dilemma: Sie appelliert an die Vernunft, aber den größten Kick haben wir, wenn wir unvernünftig sind. Wenn ich mich gezielt in Gefahr bringe, was ja tatsächlich auch passiert, hat das damit zu tun, das natürlich im Bereich des Sexuellen unser Verstand am allerwenigsten funktioniert. Das weiß jeder Leser von allein. Aber das ist die wichtige Botschaft bei HIV: Man kann eine Infektion nicht wieder rückgängig machen. Deshalb muss man versuchen - so schwer das ist - einen Rest von Verstand zu behalten, selbst wenn das Blut gerade außerhalb des Hirnes gebraucht wird.
Ist Eckart von Hirschhausen eigentlich ein glücklicher Mensch?
Ja. Es geht mir grundsätzlich sehr gut, und es ging mir auch schon vor meinem Bucherfolg sehr gut. Und hoffentlich auch noch ein paar Jahre danach...
Sie sind also kein trauriger Clown?
Den Clown mit der Träne im Auge überlasse ich den Porzellanpuppenherstellern. Das ist ein Klischee wie das, dass Deutsche grundsätzlich keinen Humor haben oder dass alle Engländer welchen hätten. Ich werde oft gefragt, wie man vom Arzt zum Komiker wird: Die Grundfähigkeit ist sehr ähnlich. Die besteht maßgeblich darin zu beobachten.
Und in Empathie...
Und Empathie, sich reinfühlen, sich vorstellen können, wie man die Perspektive wechselt. Man muss im Kopf umdrehen können auf andere, vom Patienten aus denken. Das lernt man als Arzt zum Beispiel, wenn man rechts und links verwechselt (lacht) Beobachten, Empathie und das dann auch wieder allgemeinverständlich zusammenzufassen. Das mache ich auch als Komiker. So gesehen sind Komiker gar nicht die, die im Mittelpunkt stehen, sondern eher die am Rande, die sich das Ganze belustigt, augenzwinkernd angucken.
Waren Sie eigentlich schon immer so, oder hatten Sie einen Augenblick, indem Sie die Macht des Lachens entdeckt haben?
Es gab tatsächlich einen Moment, als ich in München eine Tour durch Krankenhäuser gemacht habe...
Als Magier noch?
Genau, da war ich noch Zauberkünstler. Ich war schon mit dem Studium fertig. Ich war in der Kinderneurologie und -Psychiatrie, und da gab es ein Kind, das hatte selektiven Mutismus: Obwohl es neurologisch sprechen könnte, hat es sich entschieden nicht zu sprechen. Das ist eine psychosomatische Störung. Der behandelnde Arzt erzählte mir später, dass dieses Kind im Rahmen meiner Zaubershow, in der die Kinder ja extrem animiert sind und mitschreien, sozusagen vergessen hat, dass es nicht mehr reden wollte. Ich bilde mir nicht ein, dass das der Durchbruch war, aber das war auf alle Fälle ein wichtiger Moment im Heilungsprozess. Da habe ich gemerkt, dass Humor heilen hilft. Das Schöne am Lachen, ähnlich wie bei der Musik, ist, dass es ein Gemeinschaftserlebnis ist. Lachen ist eines der tiefsten sozialen Dinge, die man miteinander tun kann. Es ist ansteckend, ohne dass ich verstehen muss, worüber gelacht wird. Lachen und Musik geben sofort das Gefühl von Gruppenbildung.
Stört Sie eigentlich die Bezeichnung "der witzigste Arzt Deutschlands"?
Nur wenn es über jemand anderen gesagt wird. Aber mal ehrlich: Ich sehe mich auch als Pionier in einer Bewegung, die hoffentlich lange über mich hinaus Bestand hat, nämlich zu sagen: Wir müssen anders über Gesundheit und Krankheit nachdenken. Wir müssen uns klar machen, dass nicht die Ärzte im Krankenhaus oder in der Praxis diejenigen sind, die Gesundheit herstellen. Gesundheit passiert im Alltag. Gesundheit hat mit meinen täglichen Gedanken und Handlungen zu tun.
Womit wir beim Glück sind. Sie sind der Meinung, das könne man lernen.
Ich bin dafür, dass Glück ein Schulfach wird. Und damit meine ich Lebenskompetenz, psychologische Grundkenntnisse. Wie streitet man gut und konstruktiv? Wie funktioniert Kommunikation? Wie finde ich heraus, was meine Stärken sind? Das sind alles Dinge, die man später im Leben dringend braucht, die einem aber fehlen, wenn man es nicht von zuhause mitkriegt. Glücklichsein kann man lernen. Das hat sehr viel mit psychologischer Grundkompetenz zu tun. Und je früher man das im Leben lernt, desto besser. Musikmachen ist ein großer Weg zum Glück. Jedes Kind sollte singen können. Und kein Kind darf hören "Du kannst es nicht". Wir frustrieren unsere Kinder durch unser Bildungssystem auf eine Art und Weise, dass ich nicht wirklich darüber erstaunt bin, dass immer mehr Kinder rausfallen und auch zu Gewalt greifen. Das hat damit zu tun, dass sie sich nicht als gebrauchtes Mitglied einer größeren Gruppe fühlen und mehr Frust- als Erfolgserlebnisse haben.
Es gibt aber gleichzeitig die Kritik, dass Kinder in unserer Gesellschaft verhätschelt würden.
Das schließt sich nicht aus. Es gibt auch diese Sozialverwahrlosung von Kindern, die sich nicht anstrengen und trotzdem alles in den Arsch geschoben kriegen. Die sind auch nicht zu beneiden. Es geht darum, Grenzerfahrungen zu machen, sich selbst zu fordern. Und das kann man in jedem Alter üben. Wir brauchen eine neue Diskussion darüber, wofür wir eigentlich leben wollen, wozu eine Gesellschaft da ist. Politik ist eine Interessenvertretung und soll Geld verteilen nach Kriterien. Das dümmste Kriterium ist das Bruttosozialprodukt! Ständig nach Wirtschaftswachstum zu geiern, wenn es zugleich einen Ausverkauf von sozialem Kapital gibt... Was eine Gesellschaft wirklich braucht, sind engagierte Leute, die über sich selbst hinaus denken. Werden die aber nur ständig frustriert, bedeutet das eine Vernichtung an Werten, die an der Börse überhaupt nicht abbildbar ist.
Dann ist Ihr Timing aber denkbar schlecht. Wir haben die Krise. Für die meisten Menschen liegt das Glück gerade im Wirtschaftsaufschwung.
Das sind die dummen Leute. Die schlaueren Leute denken darüber nach, wie man sich unabhängiger machen kann von materiellem Reichtum. Denn das der Deutschland nicht glücklich macht, ist offensichtlich: Wir sind die viertreichste Nation der Erde, aber auf der Liste der Zufriedenheit auf Platz 35. Materieller Reichtum führt maßgeblich dazu, dass Leute sich egoistischer verhalten, dass sie auf immer größeren Wohnflächen immer einsamer werden und immer weniger Kinder kriegen.
Es geht aber nicht um Leute, die auf 200 Quadratmetern leben, sondern um Hartz-4-Empfänger, die um ein Existenzminimum kämpfen. Denen zu sagen, das Glück liege nicht im Materiellen, ist zynisch.
Da bin ich völlig bei Ihnen. Geld macht glücklich, wenn man sehr wenig hat, wenn es einen Unterschied macht in den Lebensumständen. Deshalb finde ich auch die Idee, ein Grundeinkommen einzuführen, glückstechnisch sehr zu unterstützen. Die Unzufriedenheit nimmt zu durch soziale Ungerechtigkeit. Man muss sich nur ansehen, wie arme und reiche Menschen in Südafrika oder Brasilien leben. Ich habe dort als Student im praktischen Jahr gearbeitet. Wenn die Reichen nur noch in Ghettos leben, weil die Aggressivität in der Gesellschaft durch Ungleichheit so sehr zunimmt, dann hat keiner was davon. Man muss nicht links sein, man muss nur ein bisschen nachdenken. Zufriedenheit sollte ein Staatsziel sein, und nicht nur die von Eliten. Das Thema Glück ist durchaus politisch. Es hat maßgeblich damit zu tun, wie wir miteinander leben.
Und wie findet man Glück in der Krise?
Das Beruhigende an der Krise ist - aus medizinisch psychologischer Sicht betrachtet -, dass Menschen aus schweren Zeiten gestärkt hervorgehen. Das gilt auch für Dinge, die man keinem wünscht, wie Trennungen Krankheiten, Unfälle, Tod von Angehörigen. Wenn man die Leute im Nachhinein befragt, sagen die meist: "Ja, das war hart, aber es hat mir gezeigt, was mir wichtig ist, wer meine Freunde sind, was in mir steckt. Hätte ich nicht diesen Schups gekriegt, hätte ich bestimmte Schritte in meinem Leben nicht gemacht".
Haben Sie schon mal so einen Schups bekommen?
Na klar, immer wieder.