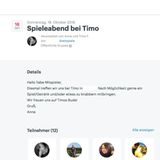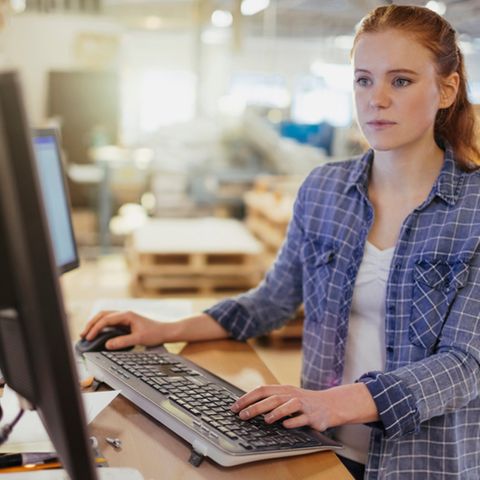Wo zur Hölle ist mein Geld? Mit dieser Frage betrachte ich Ende September mein Konto. Hinter mir und meinen Finanzen liegt ein Umzug von Berlin nach Hamburg, eine neue Wohnung (in einer der teuersten Städte Deutschlands) und zwei Mieten; aufgrund einer fehlenden Nachmieterin für mein Ex-WG-Zimmer. Vor mir liegt die neue Couch, die Studienreise und ein Konto, das jetzt schon ziemlich leer ist.
Wohin verschwindet mein Geld?
Bisher habe ich meine Finanzen immer so nebenbei im Blick behalten mit mehr oder weniger durchschlagendem Erfolg. Ich war nie pleite, einen Dispokredit bei der Bank habe ich grundsätzlich abgelehnt und auch nie etwas finanziert – und trotzdem war am Ende des Monats nicht wirklich viel übrig von meinem Gehalt. Es wird also Zeit, meine Finanzen in den Griff zu bekommen! Nach einigen Recherchen auf Finanzblogs und in Foren steht fest: Ich werde ein paar Monate Haushaltsbuch führen, um meine Finanzen zu checken. Wohin verschwindet mein Geld? Für was gebe ich überdurchschnittlich viel aus?
Der Plan ist, jeden Monat etwas zurücklegen zu können – für meinen Notgroschen und langfristig für die Altersvorsorge. Einerseits will ich mir damit ein finanzielles Polster schaffen, damit Ausgaben wie die kaputte Waschmaschine nicht meine Alltagsfinanzen ruinieren. Andererseits möchte ich einen Teil des Geldes in Aktienfonds investieren, um privat für mein Alter vorzusorgen. Um diesen Plan umzusetzen, versuche ich Budgets für Gebiete wie "auswärts Essen", "Einkaufen" und sonstige Ausgaben einzuteilen, um so herauszufinden, an welchen Schrauben ich drehen kann. Das noch viel mehr dahinter steckt, als Ratgeber zu lesen und Budgets einzuteilen, werde ich in den kommenden Wochen noch feststellen.
Ich hasse es, auf mein Konto zu schauen
"Wenn du dich fragst, ob du dir etwas leisten kannst, dann kannst du es nicht" steht in einem der Ratgeber, die ich in den ersten Tagen motiviert durchstöbere. Doch wenn ich ehrlich bin, hat sich mir die Frage nach dem "leisten können" immer gestellt. Und das, obwohl ich aus guten finanziellen Verhältnissen komme. Mir hat es nie an etwas gefehlt und ich gehöre zu einer Generation, die im Überfluss lebt. Selbst als mein Vater mal ein Jahr arbeitslos war, haben eher meine Eltern verzichtet – auch wenn damals ganz klar war, dass der Weihnachtsmann nun weniger Geschenke bringen würde. Ich habe neben der Schule und im Studium gearbeitet und würde behaupten zu wissen, was mein Geld wert ist.
Und trotzdem hasse ich den Blick auf mein Konto. Es gab Zeiten, da habe ich es einfach nicht angeschaut. Ich kaufe immer im Sale, mache mir Einkaufslisten am Anfang der Woche und auch Vorkochen und Eintuppern, oder Mealprep, wie es heute auf Insta heißt, ist für mich keine neue Erfindung. Ich aase nicht mit meinem Geld und trotzdem bin ich oft gefrustet, dass zum Sparen nichts mehr da ist.
Das Haushaltsbuch soll helfen
Bisher sind alle Versuche, ein Haushaltsbuch zu führen, an mangelnder Motivation gescheitert. Das soll sich jetzt ändern, denn schließlich brauche ich nicht nur einen Überblick, sondern bares Geld. Der neue Kühlschrank, die gebrauchte Waschmaschine und die Kaution haben riesige Lücken in meine Rücklagen gerissen. Nach Stunden auf Ebay-Kleinanzeigen habe ich vor dem Umzug beschlossen, mir doch eine neue Couch zu kaufen. Und dann gibt es noch diese Studienreise, die ich vor Monaten zugesagt habe. Was ich brauche, ist ein Plan.
Woche 1: Alles Old school
Bei meiner ersten Aufstellung der Fixkosten für Miete, Wasser, Strom und Co. bekomme ich ein flaues Gefühl im Magen. Diese leichte Panik, die in einem aufsteigt, wenn man weiß, dass etwas nicht gut läuft, man es aber spontan nicht ändern kann. Als Alleinstehende bin ich Steuerklasse eins, die Hälfte meines Gehaltes verschwindet schon auf dem Lohnzettel. Die nächste Hälfte dann nach Abzug der Miete. Fachleute und Mieterverbände raten, nicht mehr als ein Drittel seines Gehaltes für die eigenen vier Wände auszugeben. Leider sieht die Realität in Großstädten wie Hamburg oder Berlin heute oftmals anders aus, da das Angebot an Wohnung viel kleiner ist als die Nachfrage – denn für Jobs oder das Studium ziehen immer noch viele Menschen in die Großstadt.
Natürlich habe ich das Ganze vorher einmal durchgerechnet, bevor ich meine erste eigene Wohnung zugesagt habe. Nach vier Wochen Wohnungssuche in Hamburg bin ich einfach froh, nicht in einem Zelt zu schlafen. Ich habe unzählige WGs und Wohnungen angeschaut und bin dafür nach der Arbeit von Berlin nach Hamburg gependelt. Bei der Miete kann ich also erst einmal nicht sparen. Aber ich habe meinen Handyvertrag gekündigt und steige auf eine günstige Prepaid-Variante um. Beim Internetvertrag wähle ich den Bonus für unter 28-Jährige, inklusive Gutschrift und die Wochenzeitung kommt erst einmal im Probeabo.
Challenge: Keine Fast-Fashion
Außerdem will ich mich herausfordern: Keine Fast-Fashion mehr – und das bis Weihnachten. Also alles, was massenhaft bei großen Modeketten produziert wird, will ich jetzt links liegen lassen. Die nächsten drei Monate gibt es maximal Secondhand Mode von Flohmärkten oder Tauschpartys. Zwar habe ich das schon vorher gern gemacht, mich aber immer wieder von den aktuellen Trends in den Schaufenstern anlachen und zum Kauf überzeugen lassen. Ich will auf Nachhaltigkeit setzen und ein sinnvolles Teil kaufen, statt drei Frustkäufe.
Excel statt App
Nach langem Hin und Her trage ich schließlich alle Ausgaben in eine Excel-Liste ein. Die unzähligen Apps von "Mein Haushaltsbuch" bis "Mehr vom Geld" haben mir nicht zugesagt. Bei einigen musste man langwierig neue Kategorien für alles anlegen und hat am Ende trotzdem keine gute Übersicht. Bei den meisten gibt es außerdem eine Schranke für Funktionen, die man erst mit einem kostenpflichtigen Upgrade überwinden kann. Nicht gerade der sinnvollsten Anfang, wenn man eigentlich sparen will. Hinzu kommt der Aspekt der Datensicherheit: Auch wenn besonders die Pay-Varianten eine sichere Lösung versprechen, gruselt es mich, mein Gehalt und alle meine Ausgaben in einer Cloud zu teilen.
Woche 2: Die traurige Gewissheit
Die Excel-Liste füllt sich erschreckend schnell. Ich hebe Kassenzettel vom Discounter und der Drogerie auf und trage alles fleißig ein, sogar die Spenden für Obdachlose in der Bahn. Es ist wirklich kein großes Ding. Nach langem Hin und Her habe ich mich entschieden, auf der Arbeit in der Kantine zu essen, anstatt vorzukochen. Ein Essen kostet mit Mitarbeiterrabatt zwischen drei bis fünf Euro – natürlich kann man günstiger vorkochen, aber so gibt es jeden Tag ein warmes Gericht. Abends reicht dann ein Brot oder mein Geheim-Spartipp: Fertigkartoffelpüree aus der Tüte. Große Portion, macht satt und ist mit Käse und Röstzwiebeln ein wahres Soulfood.
Der Coffee-to-go-Killer
Nichtsdestotrotz versuche ich, ab und zu Essen mitzunehmen und gleiche damit andere Ausgaben aus. Vier Euro pro Tag ist mein Kantinen-Budget, das sind 80 Euro im Monat. Vorher habe ich in Blogs und Finanzforen recherchiert, was man für welche Posten aufwenden soll. Für Lebensmittel liegt der Betrag für eine Person bei circa 200 Euro – bleiben also noch 120 Euro zum Einkaufen. Auch den Kaffee auf der Arbeit und in der Kantine habe ich beschränkt, denn Coffee to Go ist ein Geldkiller. Eigentlich braucht man ihn nicht, schließlich lässt er sich leicht vorbereiten und mitnehmen. Außerdem will ich eh gefühlt jeden Tag weniger Kaffee trinken. Für ganz schreckliche Tage gönne ich mir einmal die Woche die Automaten-Version für sechzig Cent. Das Café bei uns im Unternehmen ist nur eine Alternative bei Besuch – dort ist der Kaffee zwar genial, aber hat auch Preise wie im Restaurant.
Absage statt Sushi
Doch meine Motivation weicht in den nächsten Tagen schnell einem Spar-Frust. Spätestens, als ich die Verabredung zum Sushi-Essen absage. Ungefähr fünf Mal formuliere ich den Text um, bevor ich wirklich schreibe, dass es gerade einfach zu teuer ist. Kein tolles Gefühl. Geld bestimmt immer noch soziale Zugehörigkeit. Jeder, der schon einmal in einer Stadt neu angefangen hat kennt das: Wer neue Kontakte knüpfen will, muss unter Leute. Das läuft oft nur über Veranstaltungen, auswärts Essen oder Feiern – denn mehr oder weniger Unbekannte lädt man nicht unbedingt auf einen Wein zu sich nach Hause ein. Doch wenn man sucht, gibt es auch kostenlose Alternativen: Onlineplattformen bieten zum Beispiel Sportgruppen im Park oder den Englisch-Stammtisch um die Ecke an. Die Auswärts-Essen-Falle kann man zudem mit einem Trick umgehen: Einfach später auf ein Bier verabreden und vorher zu Hause essen.
Woche 3: Oder – Ende nicht gut
Diese Woche bringt den Schock: Die Klempnerrechnung für den Anschluss der Wasch- und Spülmaschine schlägt mit 300 Euro zu buche. Das Monatsticket wird für September und Oktober rückwirkend abgebucht, der Stromanbieter bucht das erste Mal den Abschlag ab und auch die Haftpflichtversicherung für das kommende Jahr ist fällig. Ich storniere erst einmal meine Probestunde im Tanzstudio, das ich mir gern anschauen wollte. Über 30 Euro im Monat als Mitgliedschaft scheinen mir gerade utopisch, wenn ich noch Geld sparen will.
Neue Geldquellen müssen her!
In meiner ersten Panik suche ich nach weiteren Geldquellen, um meine Rücklagen wieder aufzustocken. Die Teilnahme an obskuren Studien fällt weg und auch ein Zweitjob ist aktuell keine Option; ich muss erstmal auf meinem neuen Job gut arbeiten. Also verkaufe ich online Bücher, die ich eh nicht gelesen habe und Kochfibeln, die seit Jahren in meinen Schrank stehen – vielleicht werden andere ja damit glücklich. Außerdem mache ich einen Termin beim Blutspenden. Über diese Art der Akquise lässt sich sicher streiten: Für die Blut- und Plasmaspende bekommt man eine Aufwandsentschädigung oder zumindest kostenlos Brötchen und Kaffee. Ich habe schon oft ohne Entschädigung gespendet und daher nicht das Gefühl, mein Blut zu verkaufen. Zudem muss man in Hamburg dreimal spenden, bevor es eine Entschädigung gibt – und die 100 Leute, die mit mir samstags in der Blutspendezentrale sitzen, sind sicher nicht alle aus Nächstenliebe hier. Mit zwei Spenden im Monat könnte ich das Tanzstudio bezahlen.
Läuft - nicht!?
Diese Woche ist echt kein Spar-Erfolg, denn am Wochenende werfe ich alle guten Vorsätze über Bord und kaufe neue Farbe und Streichequipment für das Wohnzimmer. Außerdem gibt es eine neue Uhr für die Küche. Kleine Sachen, die man eigentlich nicht braucht, die aber ein gutes Gefühl bereiten – und immer mehr Geld kosten, als man denkt. Erfolgreicher als gedacht läuft aber mein Fast-Fashion-Verbot. Wer schon einmal in der Fastenzeit auf Süßigkeiten verzichtet hat, kennt den Effekt: Man hat nach einer gewissen Zeit keine Lust mehr darauf. Wenn ich mal die Zeit zum Einkaufen und Schlendern finde und dann doch vor einem Schaufenster stehen bleibe, versuche ich mir immer zu sagen, dass ich die meisten Sachen so ähnlich auch in meinem Kleiderschrank habe. Und als Belohnung gönne ich mir auf dem Nachtflohmarkt einen Pullover für drei Euro.
Fazit
Nach knapp drei Wochen Sparen sieht meine Excel-Haushaltsliste gar nicht so schlecht aus. Um wirklich den eigenen Verbrauch einschätzen zu können und Ausgabenlöcher zu sehen, muss ich das Ganze aber noch länger weiterführen. Dann kann ich langfristig meine Budgets anpassen und an der richtigen Stelle sparen. Sichtbar wird aber schon jetzt, dass mein Geld bei den "unregulierbaren“ Kosten verschwindet: Die neue Wandfarbe hier, die Küchenuhr da und doch noch einmal die Zugfahrt nach Berlin. Ich muss also in Zukunft bewusster Geld ausgeben.
Unabhängig von meinen Fixkosten und längerfristigen Ausgaben wie dem Klempner, konnte ich aber bei vielen Posten durch kleine Veränderungen sparen: Verzicht auf den Coffee to go, Vorkochen und Mitnehmen oder mal nur ein Bier statt auswärts essen. Damit habe ich genauso gut gelebt wie ohne diese Veränderungen. Große Sprünge waren aber auf der anderen Seite nicht drin. Und bis meine Reserven aufgefüllt sind und ich langfristig etwas zurücklegen kann, wird es noch dauern.
Der Spar-Versuch lässt mich damit in einem Zwiespalt zurück: Auf der einen Seite lebe ich im Luxus, verglichen mit vielen Alleinerziehenden oder Menschen, die hart arbeiten und gerade einmal genug verdienen, um über die Runden zu kommen. Auf der anderen Seite frustriert es mich, 40 Stunden die Woche für ein gutes Gehalt zu arbeiten und dann Freunden absagen zu müssen, weil ich nicht mehr auswärts essen will und kann, weil das Geld sonst nicht reicht. Daher ist die Frage nicht, ob man sparen und gut leben kann, sondern jeder muss sich selbst fragen: Wann bin ich mit etwas zufrieden? Was reicht mir zum und im Leben? Sehe ich Sparen als Zwang oder als Möglichkeit, Sicherheiten aufzubauen und davon später zu profitieren? Ich für meinen Teil werde weiter Sparen, mit Haushaltsbuch und Kartoffelpüree.