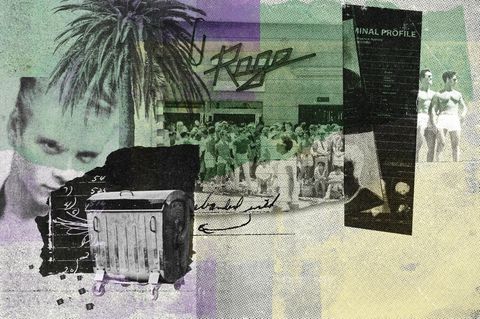Zum Start der Freibad-Saison haben erste Schwimmbäder angekündigt, die Wassertemperaturen abzusenken. Denn die steigenden Energiekosten machen den rund 6000 Bädern in Deutschland zu schaffen. Das Anheizen des Badewassers – oft mit Gas oder Öl – kommt die Betreiber teuer zu stehen.
Bereits vor einigen Wochen hat die Deutschen Gesellschaft für das Badewesen (DGfdB) einen Leitfaden mit einer Handlungsempfehlung an die Bäder herausgegeben. Die Heizung runterzudrehen, sei demnach das beste und einfachste Mittel, um Energie zu sparen. Schon zwei Grad kühleres Badewasser könnten für Hallenbäder bis zu 25 Prozent Energieeinsparung bringen, erklärt Ann-Christin von Kieter von der DGfdB der "Tagesschau".
Schwimmbäder wollen Kosten nicht auf Gäste übertragen
Diesem Rat sind einige Bäder bereits nachgekommen, beispielsweise in der Hauptstadt. "In den 37 Schwimmhallen senken wir die Temperaturen um etwa ein Grad", teilen die Berliner Bäder auf Anfrage der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" mit. Mehrere Tausend Euro sollen damit eingespart werden. Insgesamt betragen die Kosten fürs Beheizen der Bäder in Berlin 3,5 Millionen Euro im Jahr. Auch in Rheinland-Pfalz und in Niedersachsen setzt man die Empfehlung um.

Die Stadt Oldenburg, die die Maßnahme ergriffen hat, befürchtet dabei "massive Auswirkungen auf die Besucherzahlen". Das Wasser in Kinderbecken, Lern- und Therapiebecken sei laut einer Stadtsprecherin nicht betroffen, dafür müssen die Saunaanlagen zwei Grad einbüßen.
Zurückhaltender geht man in Bremerhaven vor: "Die sprunghaft gestiegenen Energiekosten wollen wir nicht auf unsere Badegäste übertragen", erklärt der Geschäftsführer der dortigen Bädergesellschaft, Robert Haase, dem NDR. Deshalb kühle man die Temperaturen in allen Hallen- und Freibädern nur um ein Grad runter. Das sei für die Gäste kaum spürbar.
Schwimmbäder hoffen auf viel Sonne
Beheizte Außenbecken bezeichnet Christin von Kieter als "ganz große Energiefresser". Dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" sagt sie: "Da gibt es Überlegungen, diese komplett geschlossen zu halten oder erst später zu eröffnen, wenn es wärmer ist". Sein Stadtbad Okeraue hat sich gegen beides entschieden, dafür aber die Temperatur im Außenbereich um drei Grad abgekühlt. Der Betriebsleiter hofft auf hohe Temperaturen, die die Becken natürlicherweise aufheizen.
Gleiches gilt in Braunschweig. Die Stadt plant keine Änderungen der Wassertemperaturen, öffnet die Freibäder aber erst später, wenn die Sonne zuverlässig für angenehme Wärme sorgt. Im hessischen Kronberg wolle man komplett auf das Heizen mit Erdgas verzichten. Der Pressesprecher der Stadt kündigt an, den Saisonstart um zwei Wochen nach hinten zu verlegen. Dann soll es möglich sein, das Wasser ausschließlich mit Solarenergie zu erwärmen.
Bei einer verschärften Energiekrise könnten die Bäder zu härteren Maßnahmen gezwungen sein, der Leitfaden der DGfdB soll die Einrichtungen darauf vorbereiten. Bei einem Stopp der Gaslieferungen aus Russland könnte es sein, dass die Schwimmbäder kurzfristig schließen müssen, um genügend Gas für den Winter zu sparen. Sollte es zum Ernstfall kommen, werde dies "sicher auch Akzeptanz bei den Badegästen finden", hofft die DGfdB.
Quellen: NDR, "Frankfurter Allgemeine Zeitung", "Tagesschau", "Redaktionsnetzwerk Deutschland"