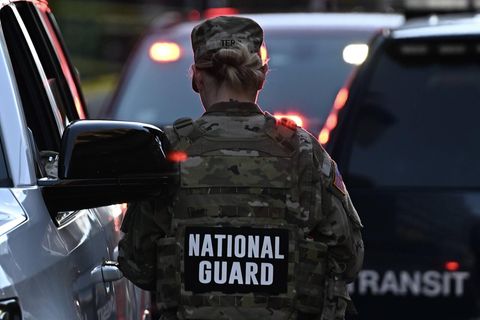Frau Hauser, herzlichen Glückwunsch. Freuen Sie sich über die Ehrung?
Im Moment freue ich mich sehr, zusammen mit meinen Kölner Mitstreiterinnen und Kolleginnen aus aller Welt. Das ist eine Anerkennung für unsere schwierige Arbeit. Ich hoffe, dass es jetzt mehr Aufmerksamkeit in der Öffentlichkeit und der Politik gibt für das, was wir zu sagen haben.
Mit dem Preisgeld wollen Sie unter anderem ein Projekt für vergewaltigte Frauen im Ostkongo unterstützen. Von dort wird berichtet, dass in den Metallminen, wo Coltan für unsere Handy-Industrie aus der Erde geholt wird, unzählige Frauen vergewaltigt werden. Ist das so, telefonieren wir gewissermaßen auf Kosten kongolesischer Frauen?
80 Prozent des Weltbestands von Coltan, das ein wichtiger Bestandteil unserer Handys ist, kommt aus den kongolesischen Minen. Dort betätigen sich seit längerem skrupellose Geschäftsbosse, Kriegsherren und internationale Konzerne. Sie beuten Frauen in ekligster Weise aus, diese müssen als lebendige Lastesel dienen und Tonnen von Material schleppen, dabei werden sie oft auch noch vergewaltigt.
Sie haben Kanzlerin Merkel öffentlich aufgefordert, die sexuelle Kriegsgewalt im Kongo und anderswo anzusprechen. Hat sie reagiert?
Bisher nicht. Vielleicht hilft ja nun dieser Preis, dass ich irgendwann eine Nachricht von ihr bekomme.
Der UN-Sicherheitsrat hat sich in zwei Resolutionen dem Thema von sexualisierter Kriegsgewalt in den Jahren 2000 und 2008 angenommen. Hat sich die Lage seither verbessert, gibt es weniger Massenvergewaltigungen in bewaffneten Konflikten?
Die Resolutionen 1325 und 1820 sind für unsere Arbeit wichtig. Wir können damit Politik machen, auch unsere Kolleginnen in Afghanistan oder Liberia können darauf verweisen. Aber die Politiker nehmen solche Resolutionen oft nicht ernst, sie sehen nicht ein, warum sie diese jetzt umsetzen sollen. Zusammen mit anderen Menschenrechtsorganisationen müssen wir dran bleiben und die Politik immer wieder auffordern, diese Resolutionen umzusetzen. In der Demokratischen Republik Kongo ist eine riesige UN-Friedenstruppe stationiert, und gleichzeitig sehen die Blauhelme hilflos zu, wie die diversen marodierenden Banden und auch die Regierungssoldaten dort immer weiter Krieg führen und massenhaft Frauen vergewaltigen. Das heißt, der Schutz von Frauen und Mädchen steht nur auf dem Papier.
Zur Person
Monika Hauser war von Geburt an "Multikulti": Sie wuchs als Tochter von Südtiroler Migranten in der Schweiz auf, ihre Muttersprache ist deutsche, ihr Pass italienisch, studiert hat sie in Innsbruck und Bologna. 1993 fuhr die angehende Frauenärztin unter Lebensgefahr ins Kriegsgebiet nach Bosnien, um den vergewaltigten Frauen zu helfen, woraus "medica mondiale" entstand. Heute lebt die 49-jährige mit Mann und Sohn in Köln.
Viele Soldaten besuchen bei ihren Auslandseinsätzen Bordelle und Prostituierte. Nur die deutschen Truppen nicht - zumindest wenn man dem Bundesverteidigungsministerium glaubt. Welches Wunder ist da mit den deutschen Jungs geschehen?
Wunder gibt es nicht, auch nicht bei der Bundeswehr. Wir prangern seit etwa zehn Jahren an, dass Kosovo, Bosnien und Mazedonien Transit- und Zielländer für Frauenhandel geworden sind. Mafiöse Gruppen haben dort gleich nach dem Ende der Kriege Bordelle mit Zwangsprostituierten aufgebaut, mittellose osteuropäische Mädchen werden dort festgehalten und regelrecht versklavt. Seit Jahr und Tag besuchen Männer aus den Friedenstruppen und den internationalen Hilfsorganisationen diese Bordelle, darunter auch Deutsche. Seit zehn Jahren haben Verteidigungsministerium und Bundeswehr nicht auf unsere Forderungen und unsere Gesprächsangebote reagiert. Sie sehen nicht ein, dass sie hier endlich präventiv vorgehen und junge Soldaten vor deren Auslandseinsatz sensibilisieren und schulen müssen. Und dass sie auch Sanktionen verhängen müssen, wenn Männer dem Verhaltenskodex der Uno und der Nato zuwider handeln. Beide Organisationen fahren hier eine "Null-Toleranz-Politik", zumindest offiziell. Nur die Deutschen übernehmen hier einfach keine Verantwortung.
In wenigen Tagen wird der Bundestag wohl das deutsche Bundeswehrkontigent in Afghanistan aufstocken. Ist das ein guter Weg für die deutsche Hilfe?
Wir monieren schon lange, dass die deutsche Strategie nicht die richtige ist. Es ist ein völlig falscher Weg, die Priorität auf das Militär zu setzen und nicht auf den zivilen Wiederaufbau. Die entwicklungspolitischen Projekte müssen stark aufgestockt werden. Nach dem Sturz der Taliban waren wir optimistisch, aber dann kam die Ernüchterung. Man kann das Vertrauen der afghanischen Bevölkerung in die internationale Gemeinschaft nur mit sichtbarem Wiederaufbau gewinnen. Das ist leider nur ungenügend erfolgt, und für die Sicherheit von Frauen und Mädchen wurde viel zu wenig getan. Deutschland hat nur wenige Männer und Frauen zum Aufbau der Polizei nach Afghanistan geschickt. Das hätte wesentlich mehr Personal sein müssen. Viele Männer, die in die afghanische Polizei eintreten, sind Analphabeten, etliche sind gewaltbereit. Wir wissen, dass in sehr vielen Polizeistationen Frauen und Mädchen, aber auch Jungs vergewaltigt werden. Wie soll die afghanische Bevölkerung Vertrauen in Rechtsstaatlichkeit und Demokratie entwickeln, wenn sie sich noch nicht einmal in eine Polizeistation trauen kann? Aber die Verleihung des Alternativen Nobelpreises gibt uns auch hier Kraft. Unsere afghanischen Kolleginnen erfahren damit eine Stärkung und bekommen größeres politisches Gewicht vor Ort.
Interview: Ute Scheub