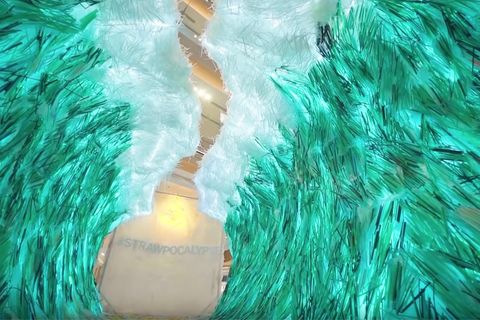Lange Zeit wurden sie etwa genauso ernst genommen wie Seeungeheuer oder Geisterschiffe: Monsterwellen, auch Freak-Waves genannt, die plötzlich und unerwartet vor einem Schiff auftauchen und sich dabei zu gigantischen Höhen von bis zu 40 Metern auftürmen können. Doch mittlerweile hat sich das Bild gewandelt: Neben immer wieder vorkommenden, nur durch Monsterwellen erklärbaren Havarien von großen Schiffen bestätigen nun auch Radarmessungen und Satellitenbilder, dass es die Riesenwellen tatsächlich gibt - und sie nicht einmal selten sind.
Sehr viel dazu beigetragen hat das interdisziplinäre EU-Projekt "MaxWave", berichtet das Wissenschaftsmagazin "bild der wissenschaft". Wetterdienste, Schiffbauer, verschiedene Universitäten und Forschungseinrichtungen wie das GKSS in Geesthacht bei Hamburg und das Deutsche Zentrum für Luft und Raumfahrt (DLR) arbeiteten darin zusammen, um möglichst viele Freak-Waves aufzuspüren, sie zu vermessen und das Rätsel ihrer Entstehung zu lösen.
Mit Radar und Satellit auf Wellenjagd
Zu den wichtigsten Werkzeugen gehört dabei ein Radarsystem namens WaMoS, das von Schiffen oder Ölplattformen aus Wellenhöhen messen kann. WaMoS deckt einen Radius von etwa fünf Kilometern ab und bestimmt alle fünf Minuten Höhe, Richtung, Länge und Periode der umgebenden Wellen.
Weiterlesen
Homepage des MaxWave-Projektes
Sebastian Junger: "Der Sturm", Ullstein-Taschenbücher, Mai 2001, ISBN: 3548362699, 8,45 Euro
Ergänzt wurden diese Messungen durch Radaraufnahmen aus dem Weltraum, die der europäische Satellit ERS 2 lieferte. Beide Datensätze zusammen ermöglichten es den Forschern, eine Weltkarte zu entwerfen, auf der Wellenprofile inklusive potenzieller Monsterwellen verzeichnet waren.
Verblüffenderweise registrierte der Satellit in den drei Wochen, die er für die vollständige Kartierung benötigte, zehn Freak-Waves - deutlich mehr, als die Experten erwartet hatten. Besonders häufig scheinen die Riesenwellen dabei zwischen Südamerika und Südafrika aufzutreten - ein Ergebnis, das sich mit Berichten von Seefahrern deckt.
Zusammenspiel von Wind und Wasser entscheidet
Warum die ungewöhnlichen Wellen genau dort gehäuft auftreten, können Meeresforscher momentan nicht umfassend beantworten. Ein Teil des Problems: Nicht alle Monsterwellen sind gleich. So unterscheiden Ozeanographen zwischen einzelnen, unregelmäßig geformten Wellen - den so genannten Kaventsmännern -, Wellengruppen aus drei schnell hintereinanderfolgenden Wellenkämmen, die auch "Three Sisters" genannt werden, und den "Weißen Wänden", die extrem steil aufragen und mehrere Kilometer lang sein können.
Allgemein scheint jedoch zu gelten, dass sich das Wasser besonders häufig zu solchen Superwellen auftürmt, wenn sich Wind und Wellen gleich schnell in die gleiche Richtung bewegen. Doch auch, wenn Meeresströmungen der Windrichtung entgegengesetzt sind, kann es zu Monsterwellen kommen: Trifft beispielsweise der Agulhas-Strom, der an der Ostküste Afrikas nach Süden fließt, auf Sturmwellen aus dem Atlantik oder dem Südpolarmeer, werden diese gestaucht und können die gefürchteten Riesenwellen bilden.
Ebenfalls verdächtigt werden Windfelder, die schnell und häufig ihre Richtung wechseln. Dabei werden Wellen aus verschiedenen Richtungen ineinander geschoben und überlagern sich - eine Situation, die möglicherweise auch zum Untergang des Fischerbootes "Andrea Gail" im Jahr 1991 geführt haben könnte, der die Vorlage für den Hollywood-Film "Der Sturm" lieferte. Bestätigt sind diese Modelle bislang jedoch nicht.
Verschlucken Monsterwellen die kleinen Wogen um sich herum?
Daher versuchen auch Mathematiker, die Entstehung der Monsterwellen zu erklären - mit einigem Erfolg. Einem norwegischen Forscherteam gelang es beispielsweise, im Computer simulierte Wellen unterschiedlicher Wellenlänge aufeinandertreffen zu lassen und dadurch eine unerwartet hohe Überlagerungswelle zu erzeugen. Das Manko: Derartig gleichmäßige Wellen wie im Modell gibt es im Ozean schlicht und einfach nicht.
Besser geeignet sind offenbar die Werkzeuge der Quantenphysik, berichtet "bild der wissenschaft". So liefert die so genannte nichtlineare Schrödinger-Gleichung, die auch den Wellencharakter atomarer Teilchen beschreibt, eine Lösung, die von den Forschern "Atmer" genannt wird: Eine Welle verschluckt die sie umgebenden anderen Wellen und bläht sich dadurch auf - sie "atmet" auf Kosten der anderen.
Wie realistisch solche Ergebnisse sind, überprüfen Forscher von der Technischen Universität Berlin: Sie übertragen die simulierten Wellen in einen 80 Meter langen und 4 Meter breiten Wellenkanal. Die Abweichungen von der theoretisch vorhergesagten Form fließen dann in die theoretischen Modelle ein und helfen dabei, sie zu verbessern.
Davon profitieren wiederum Schiffsbauer und Konstrukteure, denn sie können direkt im Wellenkanal prüfen, wie Schiffe oder Ölplattformen die Freak-Waves möglichst unbeschadet überstehen. Heute schon hilft dabei das eigentlich für die Forschung entwickelte Radarsystem WaMoS, das mittlerweile kommerziell erhältlich ist: Es warnt Kapitäne und Bohrinselbesatzungen vor herannahenden Riesenwellen - und verschafft ihnen damit vielleicht die Zeit, ihre Mannschaft in Sicherheit zu bringen.