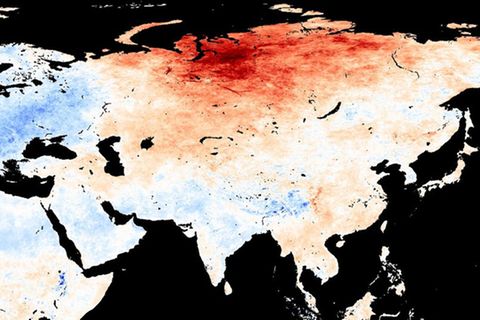Aufbruch zur Expedition
19.07.
In unserer morgentlichen Besprechung um 9 Uhr planen wir nun die Details unserer Expedition. Karsten wird zum "Finanzminister" der Expedition ernannt, der Kosten und Abrechnungsbelege im Blick behalten soll. Bastian wird unser "Proviantmeister", der Listen mit den einzukaufenden Lebensmitteln erstellt. Besondere Wünsche hinsichtlich des Essens können bei ihm angemeldet werden. Dann fahren wir mit dem Bus zu einem Großhändler, auf den Karsten zur Kostenminimierung großen Wert legt.
Vor vielen kleinen Häuschen mit den unterschiedlichsten Lebensmitteln stellen wir uns an und geben die von uns gewünschten Mengen in Auftrag. An einem Abrechnungsschalter hat man alle von uns gekauften Lebensmittel zusammengestellt. So eine Menge haben wir uns dann doch nicht vorgestellt. Es ist einiges zusammengekommen für die nächsten 20 Tage: Kartoffeln, Reissäcke, Nudeltüten, Brot, Toilettenpapier, Mehl, Hefe, Ketchup in verschiedenen Variationen und vieles mehr.
Hinzu kommt noch Ausrüstung Bodenuntersuchungen: Spaten, Äxte, Angeln, Papier für unsere Herbarien, Sägen und weiteres Werkzeug. Ganz wichtig sind besonders unsere vier Eimer, die Grundausrüstung jeder Expedition in Jakutien. Ein ganz sauberer Eimer ist für das Trinkwasser aus der Lena. Ein weitere Eimer dient der Teezubereitung. Nur zwei Eimer verbleiben zum Kochen. Also sehen wir unsere Zukunft klar vor uns: Es wird Nudeln, Kartoffeln oder Reis mit irgendeiner Soße aus dem zweiten Kocheimer geben. Ein Bus der Universität holt uns ab und bringt sämtliche Lebensmittel zur Universität, wo wir sie in einem Raum lagern.
Am Buotama
20.07.2004
Am nächsten Tag geht es los. Wir verstauen unsere Rucksäcke, die Lebensmittel und einen Stromgenerator für die Kameras und Laptops. Per Bus fahren wir mit Frau Prof. Dr. Gogoleva die Lena stromaufwärts bis zu der Stelle, wo am anderen Lenaufer der Buotama in die Lena mündet. Wir warten mit unserem Gepäck und allen Lebensmitteln am Steilufer der Lena auf ein kleines Motorboot, das uns ans andere Lenaufer bringen soll.
Unser Warteplatz an der Lena ist weiträumig übersät mit kleinen Kohlestücken, weil unter uns ein kleiner Kohleflöz verläuft, der genau an dieser Stelle an die Erdoberfläche tritt. Dies erinnerte uns wieder an eine alte jakutische Sage. Als Gott die Bodenschätze über die Erde verteilen wollte, nahm er sie alle auf seine Arme und flog um die Welt. Über Jakutien war es jedoch so kalt, dass seine Arme steif wurden und alle restlichen Bodenschätze – u.a. Kohle, Gold, Diamanten und Öl - auf dieses Land herunterregneten und so wurde Jakutien zu einem der Bodenschatz-reichsten Länder der Erde.
Die "Buotama", unser Motorboot, legt an. Über eine Holzleiter bringen wir unsere gesamte Ausrüstung auf das Schiff und legen ab. Bei unserer Fahrt über die Lena sehen wir viele Steilhänge mit den Folgen des Eisgangs aus dem letzten Winter. Viele Bäume sind die Steilhänge hinuntergefallen oder wie Streichhölzer zerknickt worden. Da der Buotama momentan nur wenig Wasser führt, müssen wir unseren Anlegeplatz am anderen Lenaufer um zwei Kilometer verlegen. Wir legen unter ca. 40 m hohen, stark überhängenden Dünen an, von denen schon viele Bäume hinabgestürzt sind.
Beim Ausladen auf dem nur wenige Meter breiten Uferstreifen zucken wir oft zusammen. Über uns rutschen die Dünenränder mit großem Krachen und manchmal knallt es sogar wie bei einem Gewehrschuss. Die Jakuten lachen und wollen uns beruhigen: "Meistens passiert nichts." Wir sind uns da nicht so ganz sicher und unser Blick geht oft sorgenvoll nach oben. Wir schleppen unsere Ausrüstung den Strand entlang und den Steilhang hinauf bis ins Lager am Zusammenfluss von Lena und Buotama. Nach dieser Schlepperei schlagen wir unsere Zelte auf, kochen Tee und setzen uns zum Abendessen zusammen. Verschwitzt und todmüde genießen wir es, einfach nur so nutzlos dazusitzen, Tee zu trinken und der Sonne dabei zuzusehen, wie sie über der Lena untergeht.
Im Mammutgebiet
8 Uhr Aufstehen, 9 Uhr Frühstücken mit Tagesbesprechung, 10 Uhr Abmarsch – dieser Rhythmus wird unsere nächsten Wochen bestimmen. Heute liegen über 25 Kilometer Fußmarsch zusammen mit jakutischen Schülerinnen und Schülern und ihrer Lehrerin vor uns. Wir werden durch die Taiga marschieren bis zu einem Dünengürtel an der Lena, den Tukulany.
Frau Prof. Dr. Gogoleva erläutert uns Besonderheiten der Taiga. Bei ca. 200 Millimetern Niederschlag im Jahr müsste eigentlich eine Wüste entstehen. Stattdessen bildetet sich hier jedoch die Taiga, die – im Gegensatz zu europäischen Wäldern - zum Versteckenspielen nicht geeignet ist. Der Permafrost verhindert das Versickern des Wassers. Da die Baumwurzeln wegen des Permafrostes sehr flach verlaufen, stehen die Bäume weit auseinander.
Lichtorientierung und Nährstoffmangel der Bäume führen zu einer Betonung des Höhenwachstums mit einer Konzentration der Blätter in der Baumkrone. Darunter gibt es wegen der großen Trockenheit kaum Blätter. In dem Bereich, in dem wir marschieren, haben wir also vereinzelt stehende dünne Stämme, die im unteren Bereich kaum Blätter tragen. Man kann weit in die Taiga hineinblicken. Es scheint schwierig, sich hier zu verstecken. Dass es irgendwie doch funktionieren muss, bemerken wir etwas später.
Wir entdecken häufiger Kot von Elchen und Bären, können jedoch keines dieser Tiere irgendwo entdecken. Manche von uns sehen sich etwas häufiger um als gewöhnlich, seit klar ist, mit welchen großen Tieren wir gemeinsam in diesem Taigagebiet sind. Taiga verbindet man gewöhnlich mit riesigen Beständen an Birken, Lärchen oder Kiefern. Definiert wird die Taiga jedoch durch eine unscheinbare, vereinzelt stehende grasähnliche Pflanze, die Limnas stelleri.
Suche nach Permafrost
Vor uns schimmert es gelblich durch die Bäume, da wir uns dem Dünengürtel an der Lena nähern. Bei uns Ostfriesen löst der Anblick dieser Sanddünen leichte Heimatgefühle aus, obwohl die ostfriesischen Dünen kaum halb so groß sind. Wir klettern auf eine über 40 Meter hohe Sanddüne und haben von hier eine wunderbare Aussicht über die Lena. Die Sonne scheint warm auf den Dünensand, auf dem nur vereinzelt Pflanzen oder Bäume wachsen.Unter uns soll sich Permafrost befinden. Nach der Theorie dringt das Regenwasser von oben ca. 50 Zentimeter in die Düne ein. Im Sommer taut die Oberfläche des Permafrostes und die Feuchtigkeit des Tauwassers durchdringt eine Schicht von ca. 50 Zentimeter oberhalb des Permafrostes.
Dazwischen soll eine Trockenzone von ein bis zwei Metern liegen, d.h. an unserer Stelle ist mit dem Permafrostboden in einer Tiefe von zwei bis drei Metern zu rechnen. Wir greifen zu unserem Spaten und beginnen mit dem Bodenaufschluss. Reihum muss jeder von uns graben. Zur Tiefenmessung haben wir einen Stock alle 10 Zentimeter markiert. Wir passieren die Zwei-Meter-Marke. Matthias gräbt inzwischen mit dem Stahlbecher von Herrn Stracke weiter, da das Loch zum Graben mit dem Spaten zu eng geworden ist.
Erste Erfolgsmeldung von Matthias. Die Erde ist so kalt, dass der Becher beschlägt. Erst auf 2,75 Metern erreichen wir den Permafrostboden. Hier geht es nicht mehr weiter. Und wie sieht so ein Permafrostboden aus? Er sieht aus wie ein gegossenes Betonfundament, grau, hart und glatt an der Oberfläche. Alle wollen den Permafrostboden einmal anfassen. Hält man seinen Daumen lange auf eine Stelle gedrückt, so taut der Permafrost etwas weg und es bleiben einige Wassertropfen übrig, die kurz darauf wieder festfrieren.
Nun untersuchen wir die Schichtungen der Erde. In der gesamten Länge von 2,75 Metern ist unser Bodenaufschluss durchnässt. Das Wasser des getauten Permafrostes und das Regenwasser haben sich vermischt. Eine Trockenzone ist hier - im Gegensatz zur Theorie - nicht vorhanden. Wir denken an die Schlammpisten auf unserer Hinfahrt und äußern die Hypothese, das dies mit den besonders starken Regenfällen dieses Jahres zusammenhängen könnte.
Frau Prof. Dr. Gogoleva teilt unsere Meinung. In einer Tiefe von 10 Zentimetern entdecken wir eine dünne schwarze Schicht. Hier vermuten wir, dass diese Schicht auf einen Dünen-Brand hindeuten könnte. Dies deckt sich mit unseren Beobachtungen während des Marsches durch die Taiga. An vielen Stellen sahen wir angebrannte Bäume. Trockenheit, Blitzschlag und Brände scheinen die jakutischen Wälder viel stärker zu prägen, als wir es aus Deutschland gewohnt sind. Unsere jakutischen Mitschüler meinen, der Wald in Jakutien brenne alle 100 Jahre einmal ab.
Jede Menge Mammutknochen
Wir schütten das Loch wieder zu und suchen eine windgeschützte Stelle an der Lena aus. Karsten und Alexander holen Wasser aus der Lena, Matthias und Bastian machen Feuer und kurz darauf gibt es Tee mit Brot. Nach einer kleinen Ruhepause machen wir uns wieder auf den Rückweg. Wir machen mit den jakutischen Schülerinnen und Schülern ein kleines Experiment zur Zerstörung der Taiga durch den Menschen. Dazu ziehen wir eine Linie und gehen daran entlang. Das Ergebnis: Zehn Personen müssen zehn Mal über die gleiche Stelle gehen und schon hat man einen deutlich erkennbaren Trampelpfad.
Unserer Meinung nach haben in diesem Gebiet einmal Mammuts gelebt. Für unsere Suche nach Mammutknochen haben wir uns unter anderem dieses Gebiet am Zusammenfluss von Lena und Buotama ausgesucht. Da die Lena im Winter nicht bis zum Boden durchfriert, gibt es unter der Lena keinen Permafrost. Von unseren jakutischen Mitschülern erfahren wir folgende Faustregel: Der Permafrostboden unter einem Fluss taut circa zur Hälfte der Fluss-Breite nach unten hin auf. Da die Lena hier um die sechs Kilometer breit ist, müsste sie also unter sich drei Kilometer Permafrostboden auftauen. Da der Permafrostboden hier aber nur 400 Meter dick ist, gibt es unter der Lena keinen Permafrost.
Nach wenigen Metern, an den Ufern der Lena, beginnt der Permafrostboden wieder. Dies können wir nach unserem Bodenaufschluss an der Lena bestätigen. In diesem Permafrostboden liegen noch viele Mammuts - tiefgefroren. Da die Steilufer von Lena und Buotama immer weiter auftauen und abbrechen, könnten hier Mammutskelette freigelegt werden. Soweit unsere Überlegungen. Auf unsere Fragen bestätigten uns unsere jakutischen Mitschüler, dass an diesen Steilhängen schon viele Teile von Mammutskeletten gefunden wurden. Sie wollen uns in den nächsten Tagen einige Stoßzähne und Mammutknochen vorstellen.
Im Moor
22.07.2004
Hinter unserem Camp waren einmal durch einen Seitenarm Buotama und Lena verbunden. Nun besteht hier ein großes Moorgebiet an einem Hang, dass ungefähr alle 10 Jahre von den beiden Flüssen noch einmal überflutet wird. Hier treffen wir auf eine Studentengruppe der Universität Greifwald, die dieses Moorgebiet untersucht. Der Leiter der Gruppe, der Niederländer Hans Joosten, führt uns, im Moor stehend und den Angriffen ganzer Mückenschwärme ausgesetzt und dementsprechend gelaunt, in die Denkweise von Mooren ein.
Moore bedecken drei Prozent der heutigen Landmassen und stellen einen großen Kohlenstoffspeicher dar. Sie verhalten sich bezüglich der Klimaveränderung recht neutral. Das Problem tritt erst auf, wenn man Moore trockenlegt. Dann kann soviel Kohlenstoff freigesetzt werden, dass sich der Kohlendioxidgehalt der Atmosphäre verdoppeln könnte, was die Klimaveränderung erheblich beschleunigen würde.
Nach 25 Zentimetern stoßen wir auf Permafrost. Die Moorpflanzen scheinen ihn vor einer Erwärmung sehr gut abzuschirmen. Ein Beispiel: Wir finden kleine Torfmoose, die im Sommer ihre Zellen mit Luft füllen können. Zugleich ändert sich ihre Farbe und wird gräulich. Luft leitet Wärme nicht gut und die gräuliche Oberfläche reflektiert viele Sonnenstrahlen. Im Winter speichern die Torfmoose Wasser in ihren Zellen und sind grün. Wasser leitet die Kälte sehr gut an die Permafrostschicht weiter.
An einigen Stellen laufen wir mit unseren Stiefeln im Moorwasser direkt auf dem Permafrost. So lernen wir, aufgrund des Oberflächenbewuchses die Tiefe des Permafrostbodens zu schätzen. Unter einer üppigen Vegetation liegt der Permafrostboden oft nicht besonders tief. An vegetationslosen Stellen hingegen liegt der Permafrostboden erheblich tiefer. Dies ist für uns wichtig, wenn wir ein Tiefkühlfach für unsere verderblichen Waren bis zum Permafrostboden graben wollen. Wir suchen uns sehr bewachsene Stellen aus, dann ist es häufig nur ein halber Meter bis zum Permafrost.
Dies Moor liegt übrigens an einem Hang. Der erste Teil des Moores wird durch Oberflächenwasser – u.a. vermutlich auch das Wasser des Permafrostbodens im Hang - gespeist und stellt ein Hochmoor dar. Der weiter unten liegende Teil ist ein Niedermoor und speist sich aus dem auf dem Permafrostboden liegenden "Grundwasser".
Mückenzerstochen kehren wir nach unserer Moorexkursion ins Camp zurück. Das Abendessen wird in Eimern serviert und schmeckt hervorragend. Abends machen wir noch ein Lagerfeuer an der Lena und singen Seemannslieder. Bastian fängt Fische mit seiner Angel, die wir gleich ausnehmen, auf einen Stock aufspießen und mit etwas Salz verspeisen.