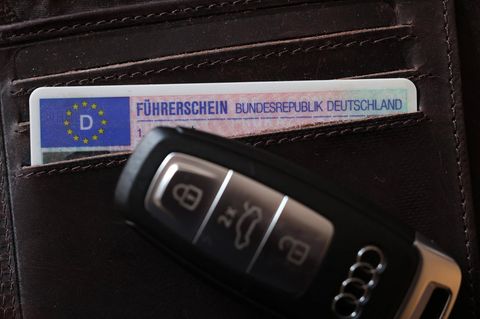Nach der grundsätzlichen Einigung auf Eckpunkte für den mittelfristigen EU-Haushalt droht der Präsident des Europaparlamentes mit einem Veto. Die Pläne sähen nur 908 Milliarden Euro an tatsächlichen Zahlungen vor, sagte der SPD-Politiker Martin Schulz am Freitag im ZDF. Weil es Ausgaben von 960 Milliarden Euro gebe, bleibe eine Finanzierungslücke von 52 Milliarden Euro. "Das findet keine Zustimmung des Europäischen Parlaments", sagte Schulz. Ein Defizit sei in Brüssel verboten. "Ich sehe nicht, wie das eine Mehrheit finden soll." Dies sei keine seriöse Politik.
Landwirtschaft und Strukturhilfen kosten am meisten
Die Staats- und Regierungschefs der 27 EU-Staaten hatten sich nach einem nächtlichen Verhandlungsmarathon über die Grundsätze für das EU-Budget der kommenden Jahre geeinigt. Ein EU-Diplomat äußerte sich am Rande des Gipfels am Freitag in Brüssel zuversichtlich, dass die Vereinbarung im Laufe des Tages abgeschlossen werden kann. Zuletzt lag für den Finanzrahmen der Jahre 2014 bis 2020 eine Summe von 960 Milliarden Euro an Verpflichtungsermächtigungen auf dem Tisch.
Ausgaben für Landwirtschaft und Strukturhilfen für die wirtschaftlich schwächeren Länder bleiben auch im neuen EU-Haushalt die größten Posten, allerdings mit abnehmender Tendenz. Deutschland wird in den kommenden Jahren mehr Geld an Brüssel zahlen als bisher, da die Wirtschaft kräftig gewachsen ist und die Regionen weniger Fördermittel brauchen.
Der "Briten-Rabatt" bleibt
Nach den bisherigen Planungen wird die Europäische Union in den kommenden Jahren damit erstmals weniger Geld ausgeben als in der Vergangenheit. Die EU-Staats- und Regierungschefs verständigten sich am Morgen in Brüssel nach Marathonverhandlungen auf Eckpunkte eines über sieben Jahre laufenden Finanzrahmens in Billionenhöhe. Er fällt gegenüber dem vorigen Plan um rund drei Prozent niedriger aus, berichteten Diplomaten am Rande des EU-Gipfels. Kanzlerin Angela Merkel setzte durch, dass das Budget genau ein Prozent der EU-Wirtschaftsleistung beträgt.
Die Verhandlungen der Staats- und Regierungschefs über den Finanzrahmen 2014 bis 2020 dauerten am Morgen an. Nach einer Verständigung auf die Obergrenzen des Etats mussten noch Einzelheiten geklärt werden.
Weitgehende Übereinstimmung gab es auch auf der Einnahmenseite des Budgets, also auch bei den umstrittenen Abschlägen für einige Länder. Großbritannien behält den "Briten-Rabatt", der vorletztes Jahr 3,6 Milliarden Euro ausmachte.
Die grundsätzliche vereinbarte Obergrenze beträgt bei den sogenannten Verpflichtungsermächtigungen 960 Milliarden Euro. Das sind rund 12 Milliarden weniger als beim gescheiterten ersten Haushaltsgipfel im November diskutiert und 33 Milliarden Euro weniger als in der vorigen Finanzplanung, die Ende des Jahres ausläuft. Verpflichtungsermächtigungen sind über mehrere Jahre laufende Zahlungsversprechen.
Für tatsächliche Auszahlungen dagegen sehen die 27 EU-"Chefs" nur 908,4 Milliarden Euro vor. Damit kam der Gipfel dem britischen Premier David Cameron entgegen, der für diesen Bereich die Marke von 900 Milliarden Euro gesetzt hatte. Gegenüber dem Zeitraum 2007 bis 2013 ist dies eine Kürzung um 34 Milliarden Euro.
Dem Kompromissvorschlag von EU-Ratspräsident Herman Van Rompuy war ein stundenlanger und hektischer Abstimmungsprozess mit Gesprächen in kleinen Runden vorausgegangen. Die "Chefs" waren am Donnerstagnachmittag zusammengekommen und verhandelten die ganze Nacht hindurch in unterschiedlichen Formationen. Kanzlerin Angela Merkel versuchte gemeinsam mit dem französischen Staatschef François Hollande, Amtskollegen in den Kompromiss einzubinden, berichteten Diplomaten.
Die Grenze bei Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von 960 Milliarden Euro bezieht sich auf die Finanzplanung im engeren Sinne. Rechnet man auch sogenannte Schattenhaushalte dazu - unter anderem die Entwicklungspolitik - so steigt die tatsächliche Obergrenze auf 997 Milliarden Euro, fast also 1000 Milliarden Euro, was als ursprüngliche Summe genannt worden war.
Bei den Rabatten soll sich auch am deutschen Beitragsabschlag de facto nichts ändern. Pro Jahr machte dies bisher rund 1,6 Milliarden Euro aus. Die Niederlande sollen 650, Schweden 160 Millionen Euro pro Jahr bekommen. Neu wäre ein Rabatt für Dänemark in Höhe von 130 Millionen Euro. Österreich würde seinen bisherigen Rabatt von knapp 100 Millionen Euro jährlich nur eingeschränkt beibehalten.
Die Staatenlenker einigten sich auch darauf, Mittel flexibler als bisher zwischen einzelnen Jahresetats schieben zu können. Sie kamen damit dem Europaparlament entgegen. Schulz als Präsident der Volksvertretung sagte, er habe ebenso wie die Mehrheit der Abgeordneten erhebliche Bedenken gegen die große Differenz zwischen Zahlungs- und Verpflichtungsermächtigungen. Die Finanzplanung bedarf noch der Billigung des EU-Parlaments.
Die größten Batzen des Budgets sind traditionell für die Landwirtschaft (373 Milliarden Euro Verpflichtungen) und die Förderung von Wachstum und armen Regionen (450,4 Milliarden) reserviert. Für eine neue Initiative zur Bekämpfung der Jugendarbeitslosigkeit werden sechs Milliarden Euro bereitgestellt.
Dazu werden 3 Milliarden Euro aus dem Europäischen Sozialfonds genommen. Für die EU-Verwaltung - und damit unter anderem die Beamtengehälter - sollen 61,6 Milliarden Euro bereitgestellt werden, das ist eine Milliarde Euro weniger als bisher vorgeschlagen.