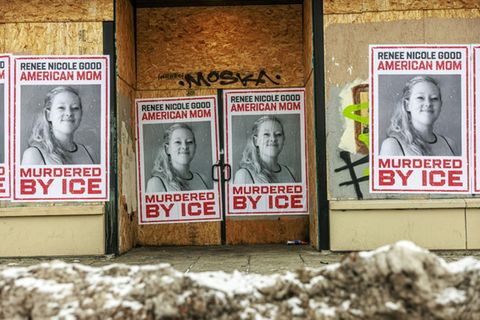Nach zähem Ringen haben sich die Euro-Finanzminister darauf geeinigt, dass sich Banken und Versicherungen freiwillig an der Rettung Griechenlands beteiligen sollen. Sie sollen die Laufzeiten von Staatsanleihen bei Fälligkeit verlängern können – wenn sie das wollen.
Der Beschluss zeigt, wie ratlos die europäischen Politiker angesichts der Griechenlandkrise sind. Sie wollen zeigen, dass sie handeln, obwohl ihre nächtliche Entscheidung letztendlich reine Symbolpolitik ist. Keine Bank wird freiwillig auf Forderungen verzichten und in Kauf nehmen, dass ihr Ergebnis schlechter ausfällt. Immerhin ist jeder Bankvorstand seinen Mitarbeitern und Aktionären gegenüber verpflichtet, gewinnorientiert zu handeln. In der Regel sehen sich Banken nicht als gemeinnützige Organisationen.
Selbst Finanzminister Wolfgang Schäuble räumt inzwischen ein, dass die Gläubigerbeteiligung ein schmaler Grat sei. "Auf der einen Seite muss es freiwillig sein, weil es sonst die entsprechenden Folgen hat", sagte er. "Auf der anderen Seite muss es auch zu einem Ergebnis führen." Damit ist der letzte Vertreter der harten Linie eingeknickt. Noch vor wenigen Tagen hatte er eine weitgehende Beteiligung privater Gläubiger gefordert, die "substantiell" sein müsse. Doch dann düpierte ihn seine Kanzlerin und einigte sich mit Frankreichs Präsident Nicholas Sarkozy darauf, private Gläubiger auf "freiwilliger Grundlage" zu beteiligen. Dass sie substantiell und freiwillig ist, davon ist jedoch kaum auszugehen.
Die Schuldenprobleme kommen nicht überraschen
Immer wieder warnen Experten davor, dass ein verpflichtender Tausch von alten Anleihen in neue mit einer längeren Laufzeit als Zahlungsunfähigkeit Griechenlands gewertet werden könnte. So argumentiert auch die EZB. Deren künftiger Präsident Mario Draghi sagte, dass alle Konzepte, die nicht auf Freiwilligkeit setzten, wegen "gefährlicher Nebenwirkungen" vom Tisch müssten. Griechische Banken könnten zusammenbrechen mit Auswirkungen auf das gesamte Euro-Finanzsystem. Das sei vergleichbar mit der Pleite der US-Investmentbank Lehman-Brothers, die das amerikanische Finanzsystem an den Rande des Kollapses brachte, so die Warnungen.
Es gibt allerdings einen großen Unterschied zu der Situation in Griechenland. Im Gegensatz zu der Lehman-Pleite kommen die Schuldenprobleme in Griechenland für keinen Finanzakteur überraschend. Die Kurse für griechische Staatsanleihen sind ohnehin schon dramatisch gesunken. Würden private Gläubiger nun auf einen Teil der Forderungen verzichten müssen, würde das für einige zwar sicherlich gefährlich werden. Die eine oder andere Bank würde vielleicht sogar bankrott gehen. Dass die Turbulenzen tatsächlich das gesamte Finanzsystem in Gefahr bringen könnten, wird von vielen Experten bezweifelt. "Sie werden sich in Grenzen halten, weil eine solche Maßnahme nicht überraschend kommen würde", sagt beispielsweise Kai Carstensen vom Münchner Ifo-Institut.
Viel Geld ist ohnehin weg
Die griechischen Schulden nehmen in einem extremen Tempo zu, so dass kaum noch jemand erwartet, dass sie jemals zurückgezahlt werden können. Die griechische Regierung steht vor der Zerreißprobe. Es ist nicht einmal sicher, ob Ministerpräsident Giorgos Papandreou im Parlament seine Sparpläne durchsetzen kann. Die sind aber Voraussetzung für weitere Finanzhilfen der Euroländer zur Abwendung des Staatsbankrotts.
Viele Ökonomen halten einen Schuldenschnitt für unabdingbar. Die Gläubiger Griechenlands, also auch die Banken, müssten auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten und die Verluste in ihre Bücher nehmen. Griechenland wäre einen Teil der Schulden dauerhaft los. Bei den Rettungspakten hingegen haftet am Ende der Steuerzahler, wenn Griechenland das Geld nicht zurückzahlen kann. Und das gilt zurzeit als sehr wahrscheinlich.
Das Problem ist, dass es derzeit keine gesetzlichen Rahmenbedingungen für den Umgang mit Staatspleiten gibt. Auf privater Ebene gibt es das Insolvenzrecht. Wenn der Schuldner seinen Verpflichtungen nicht nachkommen kann, gibt es klare Regeln, wer wie am Verlust beteiligt wird. Bei Staaten gibt es das nicht, die Gläubiger hätten bei einem Schuldenschnitt demnach die Möglichkeit zu klagen. Um in Zukunft für vergleichbare Fälle gerüstet zu sein, muss deshalb schnell eine Regelung her, damit nicht der Steuerzahler die Schulden begleichen muss.