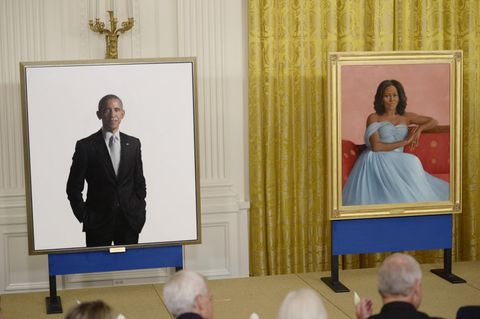Die wundersame Wandlung des Barack Obama geht so schnell vonstatten, dass manchem die Luft wegbleibt. Anfang der Woche rief der Mann, der sich noch im Vorwahlkampf nicht dafür entschuldigen mochte, dass er keine Landesflagge am Revers trägt, die "Woche des Patriotismus" aus. Dann legte der demokratische Präsidentschaftskanidat ein "Glaubensprogramm" nach, das zum Ziel hat, die evangelikalen Christen auf seine Seite zu ziehen. Das ist nicht mehr der Vorwahlkämpfer, der versucht, neuen Wind zu bringen, nuancenreich diskutiert und sich als Erneuerer präsentiert. Im Duell gegen den Republikaner John McCain, den er auch in den traditionell konservativen Bundesstaaten angreifen will, rückt Obama in die politische Mitte, energisch und effektiv.
"Politische Pirouetten"
Das entging auch den Kommentatoren nicht. "Was dem einen der Pragmatismus, ist dem anderen ein Flip-Flop", titelte die "Washington Post". Die "New York Times" vermerkte bissig: "Er hat in den vergangenen Wochen mehrere politische Pirouetten hingelegt, die ihn jedes mal näher am Zentrum des politischen Rings hat landen lassen." Als scheinbaren Trost schiebt das liberale Blatt die Erklärung des Historikers Robert Dallek hinterher: "Präsidentschaftskandidaten haben den großen Wunsch, als pragmatisch betrachtet zu werden und sie hoffen, ihre Manöver und ihre Verschiebungen werden als Teil eines höheren Zwecks gesehen. Es bedeutet nicht, dass sie total unaufrichtig sind."
Obama setzt darauf, dass das seine Wähler aus dem linken Spektrum auch so sehen. Jetzt jedenfalls macht er sich dafür stark, Kinderschänder hinzurichten. Und er versteht die konservativen Richter des Supreme Courts, die meinen, jeder Amerikaner habe ein in der Verfassung verankertes Recht, Waffen zu besitzen. Er befürwortet neuerdings auch ein Gesetz, dass den Telefongesellschaften einen Freifahrtsschein für ihren staatlichen verordneten Lauschangriff auf die Bürger gibt. Und er kritisiert die schwarzen Väter, die sich nicht genug um ihre Familien kümmerten. Schließlich wies er das System staatlicher Wahlkampfhilfe zurück, das er vor Monaten noch als Garant für eine faire politische Auseinandersetzung betrachtete.
Willkommene Hintertürchen
Bei Obama wiegt schon der Vorwurf der Unaufrichtigkeit schwer, basierte sein Vorwahlkampf doch auf einer Selbstinszenierung als politischer Saubermann, der Schluss macht mit dem schmutzigen Spiel in Washington. Trotzdem geht er volles Risiko und spielt nun selber munter mit beim Bäumchen-wechsel-dich. Dabei ist schwer auseinander zu halten, wo er nur seine bislang gütig übersehene konservative Seite betont und wo er sich als populistischer Stimmensammler betätigt. Notfalls kann er sich ohnehin darauf zurückziehen, dass er oft spricht, wie er das beim Jura-Studium in Harvard gelernt hat, eine Meinung stets mit einem qualifizierenden Nebensatz begleitend. Als Politiker eröffnet ihm das willkommene Hintertürchen.
Zum Beispiel die Todesstrafe. Als Senator im Bundesstaat Illinois setzte Obama sich für Reformen ein, die sicherstellen sollen, dass sorgsamer ermittelt wird und so die Wahrscheinlichkeit sinkt, dass Unschuldige in der Todeszelle landen. Gleichzeitig sagt Obama damals wie heute, es gebe keine Belege darfür, dass die Todesstrafe Verbrechen verhindere. Trotzdem müsse die Gemeinschaft die Möglichkeit haben, abscheuliche Verbrechen mit dem Tod zu ahnden.
Oder die Waffen. Als Sozialarbeiter in einem der ärmsten und gewalttätigsten Viertel Chicagos gehörte der Kampf gegen den freizügigen Handel von Waffen zu Obama zentralen Problemen. Gleichwohl sagte er nach der Entscheidung des Supreme Courts, der die seit 32 Jahren geltenden scharfen Waffengesetze in der Hauptstadt Washington aufhebt: "Ich habe immer geglaubt, dass der zweite Verfassungszusatz das Recht von Individuen schützt, Waffen zu tragen. Aber ich identifiziere mich auch mit dem Bedarf von verbrechensgeplagten Gemeinschaften, ihre Kinder vor der Gewalt der Straße mit vernünftigen, effektiven Sicherheitsmaßnahmen zu schützen."
Entsetzen bei Liberalen
In anderen Bereichen fällt es Obama schwerer, seine fundamentalen Richtungswechsel zu kaschieren. Liberale Bürgerrechtsgruppen und Senatskollegen sind entsetzt, dass er nun doch jenes Gesetz unterstützt, welches den Telefongesellschaften einen Freibrief gibt, im Auftrag der Regierung die eigenen Landsleute ausspionierten. Der Foreign Intelligence Surveillance Act (FISA) macht es dem Weißen Haus zudem leichter, Telefonate und E-Mails vermeintlicher Terroristen abzuhöhren. Vor den Vorwahlen in South Carolina hatte Obama noch gesagt: "Die Administration gibt uns eine falsche Wahl zwischen den Freiheiten, die uns wichtig sind, und der Sicherheit, die sie verlangt."
Dass Obama seine Zusage zurücknimmt, er werde sich im Hauptwahlkampf auf die staatliche Finanzhilfe stützen, war abzusehen, seit er einen Spendenrekord nach dem nächsten aufstellte. Seine Begründung für diesen Schritt klingt allerdings arg konstruiert. Dem staatlichen System gelinge es nicht, die Interessen der Wirtschaft und der Lobbyisten aus dem Wahlkampf herauszuhalten, behauptet er nun, nachdem er es im Frühjahr noch vorbildlich fand. Die Wahrheit ist simpler: Er nimmt derzeit rund dreimal soviel Spendengelder ein wie McCain und will diesen Vorteil nicht aufgeben.
Eher in die Rubrik Populismus fällt die Schelte für die schwarzen Väter, die er am Vatertag austeilte. Sie verhielten sich wie Jungs, nicht wie Männer, wetterte Obama: "Jeder Dummkopf kann ein Kind haben. Das heißt nicht, dass er schon ein Vater ist." So etwas kommt besonders in einer Wählergruppe an, in der Obama bislang schwer Fuß fasst: Die der weißen Arbeiter, die ihm wegen seiner intellektuellen Herkunft und seiner Hautfarbe misstrauen. Sie aber braucht er, um in den wahlentscheidenden Bundesstaaten zu gewinnen. Dafür schrecke Obama nicht davor zurück, auf alte Zerrbilder Weißer gegenüber Schwarzen zurückzugreifen, kritisiert Soziologie-Professor Michael Eric Dyson von der Georgetown University im "Time Magazine": "Die Schwarzen brauchen Jobs, keine Tiefschläge."
Am Ende versucht Obama wohl nur, eine Atmosphäre zu schaffen, die er in seinem Buch "The Audacity of Hope" so beschrieb: "Ich diene als die leere Leinwand, auf der Leute mit total verschiedenen politischen Färbungen ihre eigenen Ansichten projezieren." Und solange denen gefällt, was sie sehen, wird er gewinnen.